Wie wollen wir sterben?
-Ein ärztliches Plädoyer für eine neue Sterbekultur in Zeiten der Hochleistungsmedizin
Autor: Michael de Ridder
Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt (5. Auflage 03/2010)
ISBN-13: 978-3-421-04419-8, gebunden mit Schutzumschlag, 320 Seiten, Preis € 19,95
oder als Paperback, Pantheon Verlag, 320 Seiten, ISBN: 978-3-570-55154-7, Preis € 14,99
oder als eBook, ISBN: 978-3-641-04379-7, Preis € 11,99
Klappentext:
Sterben dürfen – die Streitschrift eines Arztes
Die Würde des Menschen muss auch und gerade bei unheilbar kranken und alten Menschen respektiert und bewahrt bleiben. Viel zu oft allerdings setzen sich Ärzte über den Willen ihrer Patienten hinweg, tun alles, was medizinisch und technisch möglich ist, und tragen so eher zur qualvollen Sterbeverzögerung als zur sinnvollen Lebensverlängerung bei. Aber Lebensverlängerung, so de Ridder, darf nie zum Selbstzweck werden. Ein leidenschaftliches Plädoyer für Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende.
Der medizinische Fortschritt der letzten Jahrzehnte hilft zahllosen Patienten, verschafft Heilung oder zumindest Linderung, rettet und verlängert Leben. Gleichzeitig hat Hochleistungsmedizin, wie sie in unseren Krankenhäusern praktiziert wird, aber auch ihre Schattenseiten. Michael de Ridder, seit über dreißig Jahren an verschiedenen Kliniken in Hamburg und Berlin als Internist, Rettungs- und Intensivmediziner tätig, plädiert dafür, Sterben wieder als Teil des Lebens wahrzunehmen und anzuerkennen. Er richtet sich damit nicht zuletzt an die eigene Zunft. Vielfach verstehen sich Ärzte in einer medizinisch-technischen Krankenhauswelt, in der alles möglich scheint, ausschließlich als Heilende. Was aber, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist? Wenn ein Patient »austherapiert« ist, wie es im Fachjargon heißt? Statt Todkranke um jeden Preis am Leben zu erhalten, müssen Mediziner lernen, in aussichtslosen Situationen ein friedliches Sterben zu ermöglichen. Gerade hier, so de Ridder, sind Ärzte gefragt, als Begleiter, als Fürsorger.

Leseprobe / Vorwort:
Es war in der Frühzeit meiner ärztlichen Ausbildung: Gerade hatte ich als junger Stationsarzt einer internistischen Station die Oberarztvisite beendet, als mir der Aufnahmearzt telefonisch einen alleinstehenden 64-jährigen Patienten im Endstadium einer Tumorerkrankung ankündigte: "Tu den am besten in ein Einzelzimmer, der stirbt sowieso bald." Der Krankentransport übergab mir einen blassen, hüstelnden und vom Tode gezeichneten Mann, der mich aus großen Augen eines ausgezehrten Gesichts anschaute. Über ein freies Einzelzimmer jedoch verfügte ich nicht und auf eine andere Station auszuweichen, war wegen fehlender Betten nicht möglich. Aber war da nicht noch ein freies Bett im einzigen Sechsbettzimmer meiner Station? Ich zögerte. Konnte ich den fünf Patienten dieses Zimmers einen zu Tode Erkrankten wirklich zumuten? Ich erschrak vor meiner eigenen Frage und begriff in diesem Moment: Das Sterben gehört ins Leben - unter Menschen! Und nicht in die Verlassenheit eines Einzelzimmers.
Eine halbe Stunde lang sprach ich mit den anderen Patienten, deren anfängliche Beklommenheit und Bedenken ich schließlich zerstreuen konnte. "Stell dir vor, du hättest Krebs im Endstadium wie er", sagte einer von ihnen in die Runde, und zu mir gewandt: "Wir nehmen den, Herr Doktor, er kriegt einen Fensterplatz!" Die anderen nickten zustimmend. Nie wieder habe ich Ähnliches erlebt: Die Patienten des Sechsbettzimmers organisierten untereinander für den Todkranken eine 24-Stunden-Sitzwache, sie saßen an seinem Bett, fütterten und wuschen ihn und lasen ihm aus der Zeitung vor. Fünf Tage später starb er, in ihrer aller Anwesenheit. Einer seiner Mitpatienten sagte bei der Entlassung zu mir: "Diese fünf Tage meines Lebens waren wichtig, ich werde sie nie vergessen."
Ich vergaß diese Episode bald und erinnerte mich an sie erst Jahre später wieder. Im Nachhinein will es mir scheinen, als spielte sie eine Schlüsselrolle in meinem ärztlichen Werdegang. Der war weniger davon geprägt, mir möglichst rasch eine klassische Medizinerkarriere als Internist zurechtzuzimmern, zügig die Beherrschung apparativer Verfahren, wie Gastroskopie oder Echokardiografie anzueignen, an wissenschaftlichen Studien teilzunehmen und mich nach Möglichkeit um eine Promotionsstelle bei einem ärztlichen "Meinungsbildner" mit der Aussicht zu bemühen, in Zukunft selbst auf den Bühnen der Medizin als Halbgott aufzutreten.
So wichtig es mir während meiner ersten Berufsjahre zweifellos war, die klinische Medizin sowie apparative diagnostische und therapeutische Fertigkeiten zu erlernen, so sah ich doch bald die für mich bedeutenderen und fesselnderen Herausforderungen des Arztberufs, von dem ich erst spät begriff, dass er tatsächlich zu meinem Traumberuf geworden war, im Unterholz der Medizin und auf ihren Brachflächen; mich zog es dorthin, wo die Ärzteschaft offenbar kapituliert hatte, ideenlos geblieben war und wirklicher Versorgungsmangel herrschte.
Wie konnte es sein, dass in einem zivilisierten und medizinisch hoch gerüsteten Land wie dem unsrigen, das sich gern das Etikett "Sozialstaat" anheftet, zahllose chronisch Kranke und Pflegebedürftige ärztlich und pflegerisch in einem Ausmaß unterversorgt waren (und sind), das schließlich den Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages auf den Plan rief? Wie war es möglich, dass gleichzeitig in der deutschen Kardiologie eine geradezu groteske, Milliardenbeträge verschlingende Überversorgung (Herzkatheter!) nachzuweisen war und immer noch ist? Welches Selbstverständnis hatte eine Ärzteschaft, die kranke Drogenabhängige in der Vor-Methadon-Ära praktisch ohne jede medizinische Versorgung ließ, weil die Medizin das Ziel ihrer Behandlung, Drogenfreiheit nämlich, zur Voraussetzung für eine Behandlung machte, ein ebenso absurdes wie inhumanes Vorgehen?
Wie konnte in dem Land, das den Entdecker des Morphiums zu seinen Bürgern zählte, die Unterversorgung Schwerstkranker mit Schmerzmitteln ein so beschämendes Ausmaß annehmen? Warum überließ man eine der heikelsten Herausforderungen, der sich die Intensivmedizin regelmäßig zu stellen hat, das Gespräch mit den Angehörigen eines Hirntoten, um ihre Zustimmung zu einer Organentnahme einzuholen, so überaus häufig gerade den jüngsten und unerfahrensten Assistenten, mit dem Erfolg, dass allzu oft die Zustimmung versagt wurde?
Kam es nicht einer Tortur gleich, dass die Medizin Patienten im zutreffend diagnostizierten permanenten vegetativen Status (sogenanntes Wachkoma) zu einem unter Umständen jahrzehntelangen Leben verurteilte, das sie von jeglicher Teilhabe ausschloss; ein Leben in der Verbannung? Schließlich, in welcher Verfassung befinden sich Ärzteschaft und Medizin, wenn die Zeitschrift LANCET, das international bedeutendste und geachtetste Medizinjournal, vor wenigen Jahren anlässlich der Aufdeckung der Bestechlichkeit des Herausgebers einer angesehenen medizinischen Fachzeitschrift einen Leitartikel mit den Worten überschreibt: "Just how tainted has medicine become?" (Wie verdorben eigentlich ist die Medizin geworden?)
Hier taten sich die Fragen und Probleme auf, die mir nahegingen und mich angesichts der Zugehörigkeit zu einer Profession, die wie keine zweite die Flagge der Ethik vor sich hertrug, herausforderten. Ein Spektrum sehr unterschiedlicher Fragen zwar, die jedoch eines miteinander verbindet: Sie alle verweisen auf Grundsätzliches; sie berühren sozusagen das Mark der ärztlichen Profession, die Prinzipien und das Koordinatensystem ihres Handelns. Und eben dies, das Interesse an den ethischen Grundlagen ärztlichen Handelns war es, was ich mir neben meiner "Pflicht", der praktischen Arbeit als Internist, Intensiv- und Notfallmediziner, zur "Kür" erkoren hatte.
Ins Fadenkreuz meines Interesses geriet mit der Zeit, unmerklich fast, das Lebensende. Sterben - in all seinen Formen und Extremen, in seiner ganzen Grausamkeit, Abgründigkeit und Unberechenbarkeit war und ist Teil meines seit Jahrzehnten zu bewältigenden Alltags. Mehr noch: Die langen Jahre, die ich als Arzt auf Intensivstationen verbrachte, die zahllosen Notarztwageneinsätze während 15 Jahren, die Leitung einer Rettungsstelle sowie die außerklinische Behandlung und Betreuung manch anderer Schwerstkranker hatten das Sterben im Lauf der Zeit zur zentralen Erfahrung meines ärztlichen Daseins werden lassen. Es schien mir eng und immer enger mit meinem Leben verbunden; ja auf gewisse Weise hatten wir, das Sterben und ich, wenn nicht Freundschaft geschlossen, so uns doch einander zugewandt, eine Erfahrung, die für mich zu einer tiefen Bereicherung dadurch wurde, dass ich am Sterben anderer teilhaben durfte.
Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. Sie ist Herzstück und roter Faden dieses Buches.
"Wir tun, was wir können" -
Vom Auftrag der Medizin am Lebensende
Wiederbelebung -
»Sie sollen das Herz massieren, nicht streicheln!«
Rezension von Winfried Stanzick (Ober-Ramstadt, Hessen):
Ein Buch wie das vorliegende des seit 30 Jahren als Internist klinisch tätigen Arztes Michael de Ridder war lange überfällig. In dem über 300 Seiten starken Werk plädiert er dafür, das Sterben als Teil des Lebens wahrzunehmen und anzuerkennen.
Was vielen Religionen seit Jahrtausenden bekannt war, ist den Medizinern und in der Folge dann auch vielen Menschen, die nun in die "Götter in Weiß" ihre Hoffnungen setzten, schon lange verlorengegangen. Ärzte, denen immer kompliziertere und natürlich auch teurere medizinische und technische Apparate ermöglichen, Menschen an einem fragwürdig gewordenen Leben zu erhalten und die, wenn ihnen das nicht gelingt, den Tod eines Patienten als persönliche Niederlage erleben, sind die eine Adressatengruppe dieses engagierten Plädoyers "für eine neue Sterbekultur in Zeiten der Hochleistungsmedizin."
Ärzte, die, wenn die Apparate nicht mehr helfen, den Sterbenden gerne dem Pflegepersonal überlassen und es nicht gelernt haben, verständlich und mit Empathie mit Sterbenden und ihren Angehörigen zu sprechen.
Statt Todkranke um jeden Preis am Leben zu erhalten, müssen Mediziner lernen, "in aussichtslosen Situationen ein friedliches Sterben zu ermöglichen." Dabei muss die Würde des Menschen, sein Recht auf Selbstbestimmung unbedingt respektiert werden.
Eine Lebensverlängerung zum Selbstzweck lehnt de Ridder ab, grenzt sich aber deutlich von denen ab, die mittels der Sterbehilfe das Schicksal des Menschen selbst in die Hand nehmen wollen.
Ein wichtiges und empfehlenswertes Buch, dem eine positive Wirkung in die Ärzteschaft hinein zu wünschen ist.
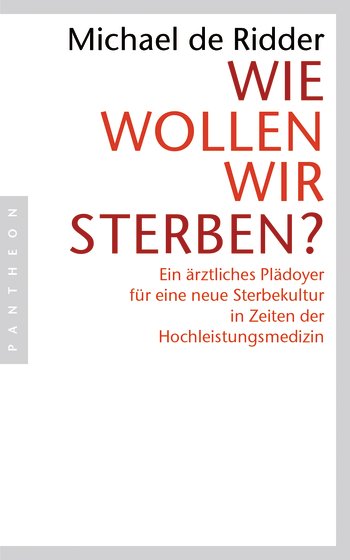 .......
.......

