Der Trickspiegel der Tabu-Pädagogik
Vom N-Wort zum M-Wort: Provinz im Namen der Welt
Wo Wörter zu Fetischen werden, verdampft der Maßstab.
Wer die Sprache angreift und reglementieren will, bekämpft Volk, Sprache und Tradition.
von Dr. Thomas Hartung | ANSAGE.org

„Ich bin selbst, per Definition des Wortes, ein Mohr“, schreibt Kacem El Ghazzali Anfang November in der “Neuen Zürcher Zeitung” (NZZ). Damit zerlegt ausgerechnet ein benannter „Betroffener“ das hiesige Taburitual: Das Sprechverbot macht aus „Mohr“ ein “M-Wort” und setzt es implizit dem “N-Wort”, dem vermaledeiten „Neger“, gleich. Genau diese Gleichsetzung aber verfehlt Geschichte, Praxis und Maß: Wer derart „kontextsensitiv“ argumentiert, erklärt den deutschen Diskurs zum Nabel der Welt.
Die Pointe sitzt: Der „Betroffene“ selbst widerspricht der Betroffenheitslogik. Er zeigt, dass „Mohr“ historisch ambivalent ist – je nach Szene deskriptiv, neutral, positiv. Die Quarantäne schafft erst jene Eindeutigkeit, die sie beschwört. Ghazzalis NZZ-Text ist ein präziser Reality-Check: Er nennt das Zürcher Schaumgebäck beim Namen, „Mohrenkopf“, und stellt es neben seine arabische Entsprechung „Ras al-Abd“, wörtlich „Sklavenkopf“. Und während hierzulande schon das M-Wort als rassistischer Hochrisikostoff gilt, wird dort der „Sklavenkopf“ unbekümmert verkauft und gegessen.

MERKE: Die politisch korrekte Bezeichnung für Negerkuss ist 'afro-amerikanischer Wangenaufdruck'.
Ghazzali, selbst Marokkaner mit dunkler Haut, betont, dass das Attribut „Mohr“ in Nordafrika stolz getragen wird – nicht als westliches „reclaiming“, sondern als historische Selbstbezeichnung. Er entlarvt die hiesige Empörung als eurozentrischen Reflex: Man verbietet ein Wort, das anderswo normal ist, und ignoriert, dass „Abd“ im arabischen Alltag weiterhin für Schwarze steht. Ghazzalis NZZ-Text ist kein „Whataboutism / Whataboutismus“, sondern ein Plädoyer für echte Kontextsensitivität – jenseits lokaler Sühnerituale.
Die herrschende Lehre jedoch reklamiert diese Kontextsensibilität: Entscheidend sei, wie ein Wort „bei uns“ klingt. Doch genau diese Argumentation entlarvt ihre eigene Provinzialität. Sie isoliert den deutschen Sprachraum und macht ihn zum Nabel der postkolonialen Welt. Wäre sie konsequent, müsste sie auch „Araber“, „Türke“ oder den veralteten „Mohammedaner“ [neu: Muslim; H.S.] problematisieren – Begriffe, die im europäischen Kolonialdiskurs pauschalisierend aufgeladen wurden. Niemand verlangt ein „A-Wort“ oder „T-Wort“. Das Universalistische schrumpft auf den Radius einer hiesigen Sühneerzählung. Kontext im strengen Sinn hieße: transkulturell lesen. Wer global reden will, muss global messen – nicht lokale Befindlichkeiten und Allergien im eigenen Umfeld universalisieren.
► Der Trickspiegel der Tabu-Pädagogik
Wo Wörter zu Fetischen werden, verdampft der Maßstab. „Mohr“ wird semantischer Hochrisikostoff; Inschriften geraten unter Kuratel; und die Kur erzeugt erst die Krankheit: Die Umschrift zum „M-Wort“ setzt das Label auf die gleiche Stufe wie „Sklave“ oder Neger – ein Kurzschluss, der die historische Textur amputiert, um ein Gefühl zu retten. Zugleich lebt die Debatte von einem professionellen Milieu, das – je weniger offenkundiger Rassismus sichtbar ist – desto fiebriger nach symbolischen Restbeständen sucht. – Die Maschine muss laufen; also muss sie fündig werden.
Diese semantische Kriegsökonomie verlagert die Energie von Taten, Institutionen, Strukturen in Silben. Während hier Fassaden gereinigt werden, heißen Backwaren andernorts „Sklavenkopf“; während man „M-Wort“ sagt, florieren reale Unfreiheiten jenseits des Blickfelds. Der Maßstab wird dort streng, wo er heimatkundlich anschlussfähig ist – und sanft, wo er das Bild stören würde. Als „sprachliche Entpigmentierung“ hat Rainer Bonhorst auf “achgut” schon vor Jahren die Spielart von Wokismus bezeichnet, Farben, Benennungen und geläufige Metaphern vorsortiert zu entwerten. [siehe Artikel auf achgut.com vom 1.09.2018; »Hat der Mohr seine Schuldigkeit getan?«; ergänzt Helmut Schnug].
Es entsteht ein Zertifikatswesen der korrekten Rede, das Bildung durch Etikettierung ersetzt. Wer die richtigen Meidungsformeln beherrscht, besteht die Prüfung; wer erklärt, statt zu meiden, gilt als verdächtig. Die Benennungspolitik im Stadtraum führt das Mechanische dieser Religion vor: Um jeden künftigen „Skandal“ zu vermeiden, benennt man lieber gar nicht mehr nach Menschen. In Gerlingen werden neue Straßen vorsorglich nach Getreidesorten getauft – Emmer, auch Zweikorn genannt, statt Erinnern. Der öffentliche Raum wird sterilisiert, Geschichte zu Nährwertangaben; neutralisiert man das Risiko, neutralisiert man das Gedächtnis.
Ähnlich agiert die Kulturverwaltung im Naturkundlichen: Die „Mohrenlerche“ verschwindet aus taxonomischen Benennungen, als ließe sich ein historisches Palimpsest mit einem Streichholz erhellen. Der pädagogische Gewinn bleibt mager, der philologische Verlust ist sicher: Wörter werden nicht gelehrt, sondern entfernt.
„Die Sprachreiniger von heute dienen nur noch ausnahmsweise der Völker- und Rassenverständigung“, empört sich Rainer Bonhorst. „Sie sind Teil einer neuen, uralten Bewegung geworden: Sie gehören der breiten Bewegung derer an, die mit Mitteln der Zensur die Freiheiten angreifen, die wir uns im Westen so mühsam erkämpft haben. Freiheiten, die die Mauren/Mohren nie hatten. Und denen wir nicht damit helfen, dass wir uns unsere Freiheiten Stück für Stück von politisch überkorrekten Zensoren beschneiden lassen.“
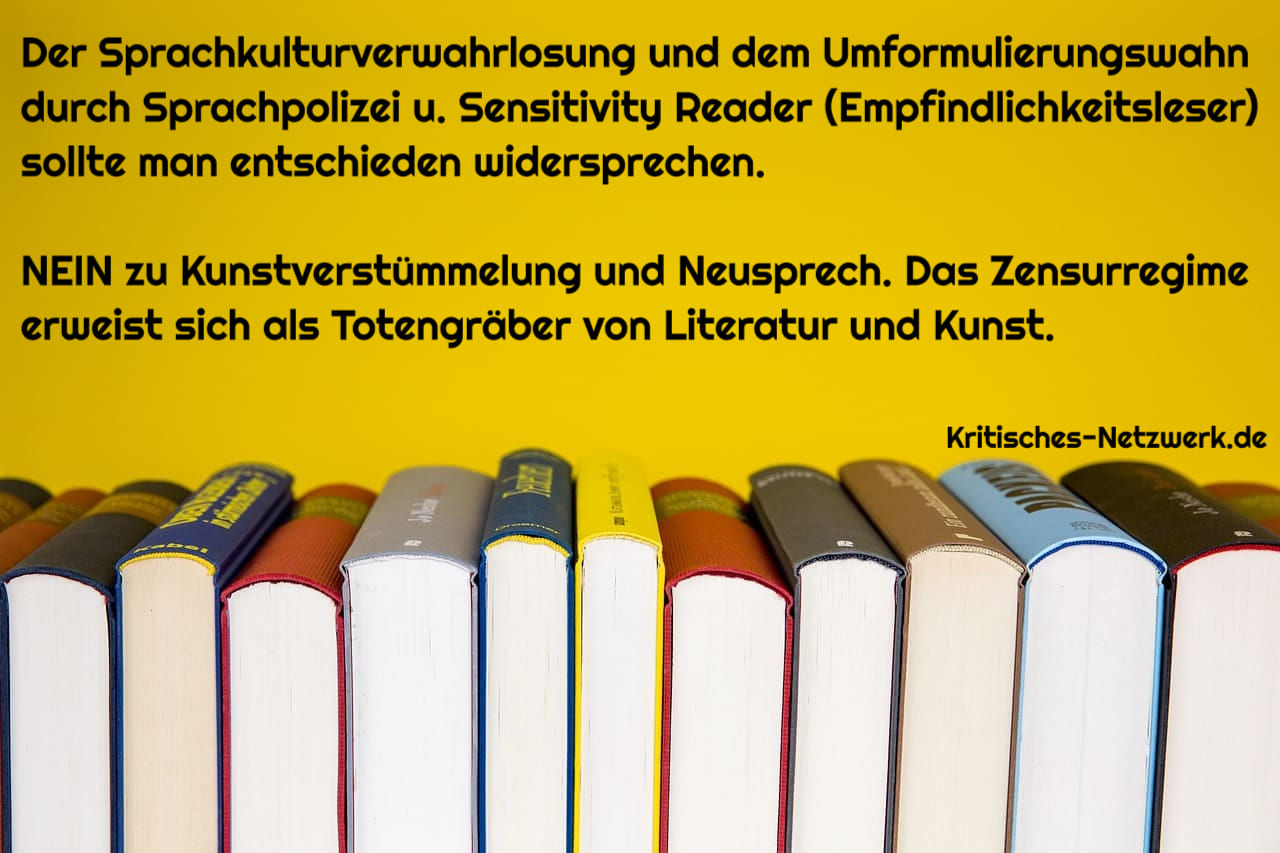
»Wenn das Denken die Sprache korrumpiert,
korrumpiert die Sprache auch das Denken«.
(-Eric Arthur Blair bekannt unter dem Pseudonym George Orwell)
► Das N-Wort als Maß aller Dinge – und was daran falsch ist
Die Gleichsetzung von „Mohr“ mit Neger als N-Wort ist der Kern des Fehlschlusses – und sie funktioniert nur, weil sie nie wirklich geprüft wird. Neger ist in Deutschland inzwischen Tabu: Wer es ausspricht, ist sofort erledigt, egal ob in Zitaten, in historischen Kontexten oder in ironischer Brechung. Die Übertragung schafft die moralische Lizenz, auch jeden Gebrauch von „Mohr“ als rassistisch zu brandmarken, ohne je nach Absicht, Kontext oder Wirkung zu fragen.
Die Analogie wirkt plausibel, weil sie auf Angst basiert: Wer will schon riskieren, als Rassist dazustehen? So wird aus einem historischen Begriff ein automatischer Ausschlussgrund. Die Zwangsbindung von Hautfarbe an ein Werturteil darf nicht mehr hinterfragt werden. Man darf nicht mehr erklären, man muss schweigen – oder umschreiben. Diese Gleichsetzung ist keine Sensibilität, sondern eine Machttechnik. Und so wird aus einer unhinterfragten Analogie ein gesellschaftliches Gesetz: Das N-Wort bleibt das absolute Böse, „Mohr“ wird sein kleiner Bruder – und wer dagegen spricht, gilt als Verteidiger des Bösen.

„Mohr“ aber war nie ein systematisches Erniedrigungswort, sondern geht wie Mauretanien auf das lateinische „maurus“ (Maure = Bewohner der nordafrikanischen Provinz Mauretanien, also Nordwestafrikaner) zurück. Das alt- und mittelhochdeutsche Lehnwort stand bereits seit dem Mittelalter nicht nur für Mauren in diesem Sinne, sondern verallgemeinert für „Menschen mit dunkler Hautfarbe“; hier spielte wiederum das griechische ἀμαυρός (“amauros”, „im Ganzen dunkel“) mit hinein.
Es wird heute vor allem in historischen oder literarischen Kontexten oder als Teil von Bezeichnungen gebraucht, zum Beispiel als Wappenfigur. Andere Quellen nehmen eine zusätzliche Transmission von St. Mauritius an, dem Anführer der Thebanischen Legion in Ägypten zur Römerzeit, der sich weigerte, Christen nur um ihres Glaubens willen zu töten, lieber selbst unschuldig sterben wollte und so zum Märtyrer wurde.
In ottonischer Zeit stieg er zum Schutzpatron des neuen Erzbistums Magdeburg auf: Im Magdeburger Dom findet man seine Plastik als Vollblut-Afrikaner. Seine Beziehung zu Apotheken beruhe darauf, wie Christian Tauchnitz für die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” recherchierte, dass er als Heilkundiger galt und die Trennung der Berufe von Arzt und Apotheker erst durch Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen im Jahre 1237 verfügt wurde.

Nach seiner eingedeutschten Namensform sind darüber hinaus viele St. Moritz-Kirchen benannt, viele Moritzburgen ebenso, etwa in Halle oder Zeitz. Wer das Wort nun für diskriminierend, kolonialistisch oder gar rassistisch hält, offenbart vor allem ein gravierendes Bildungsproblem. Mohr war also mal respektvoll, mal neutral, mal abwertend – je nach Kontext. Aber der Kontext interessiert heute nicht mehr. Es zählt nur die Gleichung: N-Wort = Böse, M-Wort = fast genauso böse. Fertig.
► Deutschland als Nabel der postkolonialen Welt
Die paradoxe Pointe: Ausgerechnet im Namen der Globalität wird der deutsche Diskurs zur Weltformel erhoben. Kacem El Ghazzali beschreibt diese Pose mit unfreundlicher Präzision: Die Deutungshoheit reklamiert „Betroffenheit im hiesigen Kontext“ als endgültigen Maßstab, erklärt zugleich aber die eigene Nullpunktsetzung zur globalen Norm. Der Diskurs gerät in jene „professionelle“ Endlosschleife: Je weniger brutaler Rassismus sichtbar ist, desto intensiver wird nach ambivalenten Formen gesucht. So wird aus einer historischen Kategorie ein reines Schreckbild; und aus dem Nachdenken über Geschichte ein Wartungsdienst für Triggerwarnungen.
Es ist ein zutiefst deutsches Bedürfnis, seine Verwerfungen in Silben einzulagern und an den Silben Buße zu tun. Die Pointe war und ist nicht die Verteidigung eines Begriffs, sondern die Kritik an einer Semantik, die den moralischen Ernst an Schaumküsse delegiert, während sie das wirkliche Böse – die Handlungen, Institutionen und Ideologien – in den Nebel entlässt.

♦ ♦ ♦
Wird die Farbe Schwarz auch verboten? Darf man noch Braun sagen?
Ist Dunkel noch erlaubt? Sollte man die Firma August Storck KG zwingen
den Namen Dickmann's für seine Mohrenköpfe zu ändern? Komplett irre!
♦ ♦ ♦
Die pedantische Lust am Etikett ersetzt das unbequeme Geschäft der Unterscheidung:
• zwischen Beleidigung und Beschreibung,
• zwischen historischer Ambivalenz und rassistischer Absicht,
• zwischen bürgerlicher Direktheit und sadistischer Herabsetzung.
Ein kleiner Exkurs mag hilfreich sein: „schwarzfahren“, „schwarzsehen“ ebenso wie „schwarzmalen“, „schwarzärgern“ et cetera liegen in der europäischen Farbsemantik begründet – schwarz im Gegensatz zu weiß als Farbe des Bösen und Schädigenden, des Zorns und der moralischen Minderwertigkeit, der Illegalität („schwarzarbeiten“, „schwarzschlachten“ und so weiter), auch des Aberglaubens und der Nacht. Manche Linguisten erkennen darin auch noch das jiddische Wort „shvarts“, das „arm“ bedeutet.
Vor allem die sich schwarz färbende Leiche [1] macht die Farbe zu jener von Trauer und Tod; der „schwarze Tod“ ist bis heute Synonym für die Beulenpest. “Schwirzen” oder “Schwärzen” ist ein Ausdruck für Schmuggeln und stammt von Menschen, die früher nachts Schmuggelgut auf ihrem Rücken über Grenzen getragen haben. Wenn man im Dunkeln nicht gesehen werden will, sollte man sein Gesicht mit Ruß schwärzen – denn tatsächlich ist die Helligkeit einer der Nachteile von Menschen weißer Hautfarbe.
Der Begriff „schwarzes Schaf“ wiederum geht auf die Wertmaßstäbe der Schafzucht zurück, wonach die Wolle weißer Schafe als wertvoller anzusehen ist, da sie sich einfacher färben lässt. Die Wolle eines einzigen schwarzen Schafes senkte die Wollqualität der ganzen Herde, weshalb solche Tiere schon in der Zucht, wenn möglich, aussortiert wurden.

► Vom Spiegel zum Fenster
Die notwendige Korrektur ist nüchtern – und anspruchsvoll.
• Erstens: Philologie vor Moralismus! Wörter sind Sedimente, keine Sakramente. Wer sie verbietet, statt sie zu lehren, zerstört Semantik, um Empfindung zu schonen.
• Zweitens: Praxis vor Pose! Wer Rassismus bekämpfen will, priorisiert Recht, Schule, Sozialordnung – nicht den Farbton der Silbe. Rassismus ist zuerst Handlung – Ausschluss, Entrechtung, Gewalt –, und erst in zweiter Linie Vokabular.
• Drittens: Transkulturalität statt Monolog! Der deutsche Diskurs ist wichtig, aber nicht allein maßgeblich; er braucht Kairo und Rabat ebenso wie Zürich und Berlin.
• Viertens: Öffentlichkeit statt Entleerung! Topographische Benennungen sind keine Gefahrenzonen, sondern Gedächtnisräume. Wer sie neutralisiert, setzt das Bündnis von Ort und Bildung aus. Erinnerung ohne Risiko ist Erinnerung ohne Inhalt.
Der Effekt der Begriffstabuisierung ist ein doppelter: In der Sprache schrumpft die Freiheit semantisch, in der Praxis schrumpft sie real. In beiden Fällen regiert die unsichtbare Axiomatik; in beiden liefert der Trickspiegel, was die Kalibrierung verspricht. Der NZZ-Text eines Autors, der sich selbst „Mohr“ nennt, ist der Ernstfall: Er macht sichtbar, was der kontextsensitive Provinzialismus überdeckt – die Vielstimmigkeit der Welt.
 Wer universale Moral reklamiert, muss universale Maßstäbe pflegen – oder ehrlich zugeben, dass es um eine provinzielle Moral, um deutsche Selbstvergewisserung geht. Die Kombination von Unwissenheit und moralischem Überlegenheitsgestus hat noch immer Unheil gebracht, warnte der Bärstadter Pfarrer Eberhard Geisler schon vor Jahren in einem Leserbrief an die “Welt”. Wer konsequent wäre, müsste „Araber“, „Türke“ und „Mohammedaner“ gleichermaßen in die Quarantäne schicken – oder die Kategorien verlassen, mit denen er das Reale zum Symboltheater verkleinert.
Wer universale Moral reklamiert, muss universale Maßstäbe pflegen – oder ehrlich zugeben, dass es um eine provinzielle Moral, um deutsche Selbstvergewisserung geht. Die Kombination von Unwissenheit und moralischem Überlegenheitsgestus hat noch immer Unheil gebracht, warnte der Bärstadter Pfarrer Eberhard Geisler schon vor Jahren in einem Leserbrief an die “Welt”. Wer konsequent wäre, müsste „Araber“, „Türke“ und „Mohammedaner“ gleichermaßen in die Quarantäne schicken – oder die Kategorien verlassen, mit denen er das Reale zum Symboltheater verkleinert.
Die Republik braucht keine neuen Buchstabenverbote, sondern Leser: die Ambivalenz historischer Wörter auszuhalten; den Streit im öffentlichen Raum zu wollen; Maßstäbe über Sprachgrenzen hinweg zu prüfen; Erinnerung nicht zu glätten, sondern zu erläutern. Das ist der Schritt vom Spiegel zum Fenster – weg von der Selbstbespiegelung, hin zur Erfahrung.
• Wer Aufklärung will, beginnt bei der Axiomatik: Wörter sind Werkzeuge, keine Sakramente.
• Wer Gerechtigkeit will, schaut auf Handlungen.
• Wer Welt will, verlässt den Spiegel.
Der Rest ist Pädagogik – und die genügt weder der Geschichte noch den Lebenden.
Dr. Thomas Hartung
 Sprach-Begriffe, zusammengestellt von Helmut Schnug:
Sprach-Begriffe, zusammengestellt von Helmut Schnug:
Sprachabschottung, Sprachakrobatik, Sprachanspruch, Spracharmut, Sprachästhetik, Sprachauffälligkeiten, Sprachautorität, Sprachbagatellisierung, Sprachbarrieren, Sprachbegabung, Sprachbedeutung, Sprachbeherrschung, Sprachbelehrung, Sprachbewahrung, Sprachbewusstsein, Sprachdefizite, Sprachdeformation, Sprachdiarrhoe, Sprachduktus, Sprachdurchfall, Sprache, Spracheigenheit, Spracheigentümlichkeit, Spracheloquenz, Sprachentwicklung, Sprachencodes, Sprachenerhaltung, Sprachenmischung, Sprachenmix, Sprachentwicklung, Sprachentfremdung, Sprachentgleisung, Sprachentwertung, Sprachenvielfalt, Sprachenwirrwarr, Sprachexperimente, Sprachfacettenreichtum, Sprachfähigkeit, Sprachfertigkeit, Sprachförderung, Sprachförderkurse, Sprachgebrauch, Sprachgedächtnisverlust, Sprachgefühl, Sprachgemeinschaft, Sprachgenuss, Sprachgewandtheit, Sprachgrenzen, Sprachgut, Sprachhüter, Sprachideologien, Sprachimperialismus, Sprachkenntnisse, Sprachkompetenz, Sprachkonfessionalisierung, Sprachkönnen, Sprachkontrolle, Sprachkonstrukte, Sprachkreativität, Sprachkultur, Sprachkulturverwahrlosung, Sprachkunst, Sprachlevel, Sprachlupe, Sprachlust, Sprachmacht, Sprachmanipulation, Sprachmissbrauch, Sprachmoralisierung, Sprachmüll, Sprachniveau, Sprachniveausenkung, Sprachnorm, Sprachnormierung, Sprachnuancen, Sprachordnung, Sprachoverkill, Sprachparfüm, Sprachpedanten, Sprachpedanterie, Sprachperformanz, Sprachperversion, Sprachpervertierung, Sprachpflege, Sprachpfuscher, Sprachpfuscherei, Sprachpolemik, Sprachpolitik, Sprachpolizei, Sprachpräzision, Sprachqualifikation, Sprachqualität, Sprachraum, Sprachreduktion, Sprachregeln, Sprachregelungen, Sprachregime, Sprachreglementierung, Sprachreiniger, Sprachsäuberung, Sprachschlamperei, Sprachschleifung, Sprachschwellen, Sprachschöpfung, Sprachseuche, Sprachsimplifikation, Sprachspielereien, Sprachstandards, Sprachsteuerung, Sprachstil, Sprachstörung, Sprachtrick, Sprachumgestaltung, Sprachunterricht, Sprachverarmung, Sprachveränderung, Sprachverballhornung, Sprachverbot, Sprachverbreitung, Sprachvereinfachung, Sprachverfall, Sprachverfälschung, Sprachverflachung, Sprachverfremdung, Sprachvergewaltigung, Sprachvergiftung, Sprachverhunzung, Sprachverklausulierung, Sprachvermischung, Sprachvermögen, Sprachverlotterung, Sprachversimplifizierung, Sprachverständnis, Sprachverständnisschwelle, Sprachverstärker, Sprachverunstaltung, Sprachverwendung, Sprachverwahrlosung, Sprachverzerrung, Sprachwandel, Sprachwillkür, Sprachwirkung, Sprachwissen, Sprachwitz, Sprachzerstörung, Sprachzwang,
(146, Stand: 27.11.2025).
[1] Warum werden Leichen schwarz? Was ist für die Schwarzfärbung verantwortlich?
Leichen werden, vor allem wenn diese noch frisch sind, an den unteren Stellen durch die natürliche Schwerkraft dunkel. Leichenflecken können innerhalb von Minuten bläulich-schwarz werden, wenn das Blut sich sammelt und an den tiefsten Stellen absetzt.
Der Verwesungsprozess, der nach ein bis zwei Tagen beginnt, führt zu einer grünlich-schwarzen Verfärbung der Haut durch bakterielle Zersetzung, die nach mehreren Tagen weiter zu einer schwarzbraunen Farbe fortschreitet. Die Augen können durch Austrocknung der Hornhaut nach 1–2 Stunden trüb und später schwarz werden. Das Gewebe zersetzt sich, es kommt zu Ausgasungen und zur Verwesung, der Körper löst sich auf. Schwarz werden vorallen Mumien. Diese trocken eben einfach aus und verfärben sich wie ein Stück altes Fleisch was abhängt. (Schinken ist auch dunkel)
► Quelle: Der Artikel von Dr. Thomas Hartung wurde am 12. November 2025 unter dem Titel »Vom N-Wort zum M-Wort: Provinz im Namen der Welt« erstveröffentlicht auf ANSAGE.org >> Artikel und HIER. HINWEIS: Der Gründer dieser Seite, Daniel Matissek, gewährte auf Anfrage in einem Email vom 22. Juni 2022 sein Einverständnis und die Freigabe, gelegentlich auf ANSAGE.org veröffentlichte Artikel in Kritisches-Netzwerk.de übernehmen zu dürfen. Dafür herzlichen Dank. Das Urheberrecht (©️) an diesem und aller weiteren Artikel verbleibt selbstverständlich bei den jeweiligen Autoren und ANSAGE.org.
ACHTUNG: Die Bilder, Grafiken, Illustrationen und Karikaturen sind nicht Bestandteil der Originalveröffentlichung und wurden von KN-ADMIN Helmut Schnug eingefügt. Für sie gelten folgende Kriterien oder Lizenzen, siehe weiter unten. Grünfärbung von Zitaten im Artikel und einige zusätzliche Verlinkungen wurden ebenfalls von H.S. als Anreicherung gesetzt, ebenso die Komposition der Haupt- und Unterüberschrift(en) geändert.
► Bild- und Grafikquellen:
1. Negerkuss, Mohrenkopf, Mohrenkuss, Negerschaumkuss, Schokokuss, Schokoschaumkuss, Schaumkuss mit Migrationshintergrund, Dickmann - RASSIST! Mit oder ohne Schaum an der Gosch - in dieses Land kann jeder ohne Ausweisdokumente einreisen, eine Ausweisung ohne Dokumente ist aber selbst bei gebotener Notwendigkeit nicht möglich. Für die einheimische, schon länger hier lebende Bevölkerung brauchts aber fälschungssichere Ausweisdokumente. – Wer die Sprache angreift und reglementieren will, bekämpft Volk, Sprache und Tradition.
Die ersten Schokoküsse sollen um 1800 in Dänemark hergestellt worden sein. Im 19. Jahrhundert entstanden in Konditoreien in Frankreich „Tête de nègre“, auf Deutsch „Negerkopf“, hergestellt aus einer baiserartigen Masse und einem Schokoladenguss. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es sie auch in deutschen Konditoreien. In Deutschland werden jährlich ca. 1 Milliarde Schokoküsse verzehrt. Die Bezeichnungen Negerkuss und Mohrenkopf werden in jüngerer Zeit wegen der rassistischen Konnotation der Ausdrücke Neger und Mohr im offiziellen Sprachgebrauch größtenteils vermieden. Die Bezeichnungen werden aber zum Teil noch von den herstellenden Unternehmen verwendet.
MERKE: Die "politisch korrekte" Bezeichnung für Negerkuss ist "afro-amerikanischer Wangenaufdruck". Foto OHNE Textinlet: Alexander Stein, Niedernhausen/Deutschland. Herr Stein ist ein deutscher Komponist, Studiomusiker, Musikproduzent und Toningenieur. >> alexanderstein.com/. Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Foto. Der Text wurde von Helmut Schnug eingearbeitet.
2. Der Sprachkulturverwahrlosung und dem Umformulierungswahn durch Sprachpolizei und Sensitivity Reader (Empfindlichkeitsleser) sollte man entschieden widersprechen. NEIN zu Kunstverstümmelung und Neusprech. Das Zensurregime erweist sich als Totengräber von Literatur und Kunst. Foto OHNE Text: Hermann Traub, Ulm (user_id:130146). Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Foto. Der Text wurde von Helmut Schnug in das Bild eingearbeitet.
3. Symbolfoto: Mund zugeklammert (zugetackert): Massenkonditionierung, Meinungsunfreiheit, Staatsrepression, Sprechverbot, Sprachreinigung, Zensur. Die letzten Regierungskoalitionen in Deutschland, die korrupte EU, aber auch die meisten totalitären, pseudodemokratischen Regierungen zahlreicher Länder unternehmen beinahe alles, um kritische Stimmen auf perfide Weise zum Schweigen zu bringen, die Masse zu konditionieren und die Meinungsfreiheit einzugrenzen (Debattenverengung, Denknarrativ, Meinungshoheit, Meinungsmacht). “Die Regierung kann ihre Positionen nicht verteidigen und will deshalb die Opposition zum Schweigen bringen. Das ist es, was passiert.” (-Scott Ritter).
Illustration: inactive account (user_id:1445917). Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Illustration.
4. Darstellung des hl. Mauritius als Mohr im Dom St. Mauritius, Magdeburg. Der Heilige Mauritius ist eine in Fragmenten überlieferte Sandsteinskulptur und entstand um 1240/50. Seit 1955 befindet sie sich im Chorraum des Magdeburger Doms. Es handelt sich hierbei um die früheste bekannte Darstellung eines dunkelhäutigen Heiligen und ist zudem eine der eindrucksvollsten Skulpturen des deutschen Mittelalters. Die eigentliche Größe des Werkes wird auf ca. 150 cm geschätzt, da es jedoch nur noch als Fragment vorhanden ist, hat die Skulptur eine letztendliche Höhe von 115 cm.
Bei dem überlieferten Fragment handelt es sich um den Torso des Dargestellten, die Beine sind abgeschlagen. Dass solche vorhanden waren, erkennt man deutlich an der Unteransicht der Statue, an der noch die Bruchkanten zu sehen sind. Man vermutet, dass das linke Bein in einer leicht vorgesetzten Position war und das rechte Bein als Standbein ausgelegt wurde.
Der hl. Mauritius († um 290) wurde – ähnlich wie auch der heilige Gregorius Maurus – aufgrund seines Namens in langer Tradition als Mohr gesehen. Nicht selten wurde im deutschen Alltagssprachgebrauch aus dem Vornamen Mauritius bzw. Maurus die geschliffene Kurzform Mohr.
Der Legende nach war Mauritius der Führer der thebäischen Legion, die dazu aufgefordert wurde, an der Christenverfolgung mitzuwirken. Da die Legion selber nur aus Christen bestand, setzten sie sich über den Auftrag hinweg. Sie wurden auf Befehl des Kaisers angegriffen. Mauritius sprach seiner Armee Mut zu und stärkte ihre Überzeugung, sodass sie nicht einknickten. So wurden sowohl er als auch seine Legion getötet. [..]
Der hl. Mauritius war der Lieblingsheilige des Kaisers Otto des Großen. Magdeburg wurde zum Lieblingsaufenthaltsort Ottos und so machte er den Grenzstapelplatz in Magdeburg zur „Pflegestätte der Verehrung“ des Mauritius. Mit der wachsenden Bedeutung und Stärke der Stadt wuchs schließlich auch die Mauritiusverehrung. (>> Auszug aus dem Wikipedia-Artikel).
Foto: Mar Yung. Quelle: Magdeburger Dom / Cathedral. Bildquelle1: Flickr. Bildquelle2: Wikimedia Commons. Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 2.0 generisch“ (US-amerikanisch) (CC BY 2.0) lizenziert.
5. Gehört der Begriff "Mohrenkopf" verbannt? Wo liegt die Grenze des Sagbaren? Wer will sieht in Allem etwas Rassistisches. Das sollte mal aus den Köpfen, nicht einfach eine Namensänderung. – Wird die Farbe Schwarz auch verboten? Darf man noch Braun sagen? Ist Dunkel noch erlaubt? Sollte man die Firma August Storck KG zwingen den Namen Dickmann's für seine Mohrenköpfe zu ändern? – Komplett irre!
Die Bezeichnung Mohrenkopf (auch Othello oder Schokoladenballen) wird für verschiedene kleine Gebäcke verwendet. Die Bezeichnung „Mohrenkopf“ (Kopf eines Mohren) ist eine Übersetzung des französischen tête de nègre und ist 1892 in Leipzig erstmals belegt. Es ist ein Gebäck aus Othellomasse (Biskuit), das gefüllt und mit Schokolade oder Kuvertüre überzogen ist. In einigen Gebieten des deutschen Sprachraums, insbesondere in der Schweiz, bezeichnet man damit den Schokokuss. Im Englischen ist auch der Begriff „Angels’ head“ gebräuchlich.
In den Werken des Dudenverlags wurde der Ausdruck Mohrenkopf seit 2012 mit dem Hinweis versehen, er werde oft als diskriminierend empfunden, in neueren ist er als veraltet und diskriminierend gekennzeichnet. >> Wikipedia-Artikel Mohrenkopf und Schokokuss.
Foto OHNE Textinlet: Richardhauck (user_id:3428202). Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Foto. Das Textinlet wurde von Helmut Schnug in das Bild eingearbeitet.
6. Schwarzes und weißes Schaf: Der Begriff „schwarzes Schaf“ geht auf die Wertmaßstäbe der Schafzucht zurück, wonach die Wolle weißer Schafe als wertvoller anzusehen ist, da sie sich einfacher färben lässt. Die Wolle eines einzigen schwarzen Schafes senkte die Wollqualität der ganzen Herde, weshalb solche Tiere schon in der Zucht, wenn möglich, aussortiert wurden. Foto: PIX1861 / Csaba Nagy, Ungarn (user_id:468748). Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Foto.
7. Ausrufezeichen. Illustration: Dark_lone_nature vormals: pramit_marattha / Pramit Marattha, Kathmandu/Nepal (user_id:3815284). Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Illustration.


