Unsere Schulen müssen demokratisiert werden
Unsere weitestgehend nutzlosen Bildungsinstitutionen
Ein pädagogisches Paradoxon
von Patrick Zimmerschied | RUBIKON

Der Erziehung zu einem mündigen Bürger liegt ein fundamentales Problem zugrunde, auf das bereits Immanuel Kant in seiner Abhandlung über Pädagogik verwiesen hat: „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ Auch über 200 Jahre nachdem er seine Schrift verfasst hat und Generationen von Philosophen und Erziehungswissenschaftlern nach ihm dieser Frage auf den Grund gegangen sind, haben es unsere Gesellschaft und ihre weitestgehend nutzlosen Bildungsinstitutionen nicht geschafft, all die Erkenntnisse vergangener Geistesgrößen in ein funktionierendes staatliches Schulsystem umzusetzen.

Das Recht auf Bildung, das in der 'Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' (AEMR) und zusätzlich in der 'UN-Kinderrechtskonvention' (KRK) seinen einflussreichsten Ausdruck fand, hat als Ziel die Emanzipation Minderjähriger, führt jedoch in der Praxis in nahezu allen Schulen zu regelmäßigen und zahlreichen Verletzungen gerade solcher Kinderrechte. Kinder werden dort normalerweise nicht, wie in der UN-Kinderrechtskonvention gefordert, als aktive und kompetente Bürger und Rechtssubjekte betrachtet, sondern vielmehr als unmündige, defizitäre Menschen, deren Mängel in den Bildungsinstitutionen behoben werden müssen [1].
Zudem kritisierte der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz, [bei seinem 10-tätigen Besuch in Deutschland; H.S.] im Februar 2006 neben diskriminierenden Mängeln im deutschen Schulsystem auch die restriktive deutsche Schulpflicht, die alternative Lernformen kriminalisiere [2]. [>> Deutschlandbericht; H.S.]

Tatsächlich wird die Schulpflicht aber oft aus der UN-Kinderrechtskonvention abgeleitet. Bei genauerer Betrachtung der entsprechenden Artikel wird deutlich, dass der zwingende Charakter von Bildung dort in direktem Zusammenhang mit ihrer Eigenschaft als Recht steht, ohne einer logischen Begründung, warum aus einem Recht plötzlich eine Pflicht folgen sollte. Es erscheint wie ein seltsamer Denkfehler, der zu der paradoxen Situation führt, dass ein Menschenrecht zugleich zu einer Pflicht des Trägers dieses Rechtes wird. Eigentlich steht einer Pflicht immer ein Recht gegenüber. Das heißt, man erbringt eine Pflicht für jemanden, der ein Recht darauf hat. Sonderbarerweise sind die beiden Personen in diesem Fall allerdings identisch [3].
► Es gibt eine doppelte Antinomie
In vielen Ländern, in besonderem Maße in Deutschland, ist die „befreiende Pflicht“ zur Bildung deckungsgleich mit der Pflicht, sich in die Institution Schule einzufügen, um die Weitergabe dieser notwendigen Bildung zu gewährleisten.
Damit Kindern kritisches Denken und demokratische Prinzipien vermittelt werden, versetzt man sie folglich durch die Schulpflicht in eine Situation, in der sie einer Autorität gehorchen müssen und ihre Grundrechte in erheblichem Maße beschnitten werden, also genau das vorgegeben ist, was durch diese Begriffe ausgeschlossen wird.
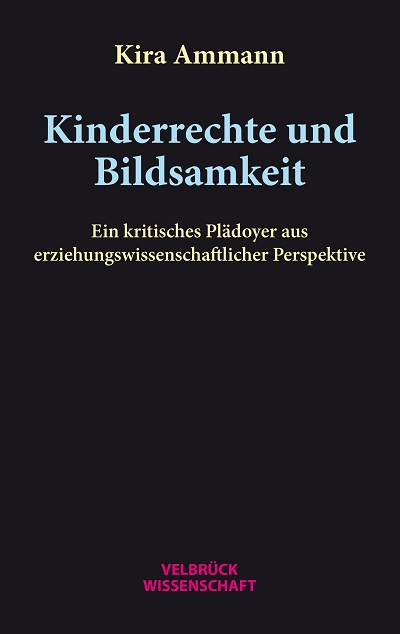 Damit in direktem Zusammenhang steht außerdem das Dilemma, dass die angestrebte Mündigkeit der Schüler eben nicht vermittelt werden kann, sondern sich entwickeln muss. Der entsprechende Lerninhalt ist kein Wissen, sondern eine Erkenntnis. Es entsteht also eine doppelte Antinomie, bei der einerseits der Lehrende zielgerichtet handelt, er aber zugleich unwissend über die genauen Folgen seines Vorgehens ist, und andererseits die Autonomie der Schüler in einem Kontext von Restriktionen und Reglementierungen gefördert werden muss, in dem sie sich nicht freiwillig befinden.
Damit in direktem Zusammenhang steht außerdem das Dilemma, dass die angestrebte Mündigkeit der Schüler eben nicht vermittelt werden kann, sondern sich entwickeln muss. Der entsprechende Lerninhalt ist kein Wissen, sondern eine Erkenntnis. Es entsteht also eine doppelte Antinomie, bei der einerseits der Lehrende zielgerichtet handelt, er aber zugleich unwissend über die genauen Folgen seines Vorgehens ist, und andererseits die Autonomie der Schüler in einem Kontext von Restriktionen und Reglementierungen gefördert werden muss, in dem sie sich nicht freiwillig befinden.
Es gibt zwei entgegengesetzte Handlungsalternativen an den extremen Enden des Spektrums der Möglichkeiten, um mit dieser Situation umzugehen: Entweder man bleibt passiv und hofft darauf, dass die erwünschten Einsichten irgendwann von selbst eintreten werden, oder man formuliert normative Grundsätze und setzt diese als absolut. Beides ist problematisch, da einmal einer mehr oder weniger willkürlichen Sozialisation die Verantwortung überlassen wird, und im anderen Fall über die Sinnhaftigkeit bestimmter gesellschaftlicher Regeln nicht durch die vernünftige Entscheidung des Individuums geurteilt wird [4].
► Kann Schule überhaupt eine positive erzieherische Wirkung haben?
Natürlich kann man einwenden, dass die Erfolgsaussichten von Erziehung nicht völlig unkalkulierbar sind und man im Unterricht durchaus einigermaßen präzise an das Denkvermögen und die Einsichtsfähigkeit der Lernenden appellieren kann, ohne davon ausgehen zu müssen, dass das gesamte Unterfangen völlig ins Leere laufen wird.
Doch wer entscheidet letztendlich über die Qualität der Ergebnisse schulischer Einflüsse? Die Lehrperson? Das Kollegium? Der Schulrat? Die Studienergebnisse der Erziehungswissenschaftler? Oder doch diejenigen, deren Bestes von allen Beteiligten angeblich gewollt wird? Deren Urteil ist jedoch in den meisten Fällen alles andere als schmeichelhaft.
Auch wenn Schule heute Humanität und Toleranz anstrebt und als eine sinnvolle Ordnung und hilfreiche Unterstützung dienen soll, sehen die von ihren Auswirkungen unmittelbar Betroffenen generell diese Einrichtung mit Desinteresse bis Ablehnung. Es stellt sich, bei all diesen Hindernissen und Widersprüchlichkeiten, ganz grundlegend die Frage, ob Schule in ihrer aktuellen Form überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine positive erzieherische Wirkung entfalten kann [5].
An diesen Zweifel anschließend, muss man folgerichtig auch die Sinnhaftigkeit der Schulpflicht überdenken, die ja einen Erziehungsauftrag erfüllen soll. Erziehung ist dabei im modernen Sinne gemeint, nämlich, dass sie Menschen urteilsfähig werden lassen soll und damit für das Recht konstitutiv ist [4].
Die darin zum Ausdruck kommende tautologische Natur der Schulpflicht liegt in ihrer Eigenart begründet, ein Recht auf Bildung zu sein, das per definitionem optional ist, aber zu dessen Aufkündigung niemand autorisiert ist, bis es vollständig ausgeübt wurde und man damit, zumindest theoretisch, ein mündiger Bürger ist. Doch selbst wenn man das zirkelhafte Wesen dieser Argumentation akzeptiert, sollte das Recht der betroffenen Subjekte, angehört zu werden, dennoch Beachtung finden [3].

► Der Wille des Kindes muss ernst genommen werden
Das Recht auf Gehör ist auch in Artikel 12 — und damit verbunden in den Artikeln 13, 14, 15 und 16 — der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) ausformuliert und stellt einen deutlichen Perspektivenwechsel dar: vom Kind als Objekt und schutzbedürftigen Wesen, das auf die Fürsorge von Erwachsenen angewiesen ist, hin zu einem Subjekt mit dem Recht auf Respektierung der eigenen Meinung. Die Partizipationsrechte in den genannten Artikeln sind nicht nur einfach mit kindlichen Bedürfnissen begründet, sondern mit der Vorstellung, dass Kinder spezielle Interessen haben, die sie selbst erkennen und vertreten können.
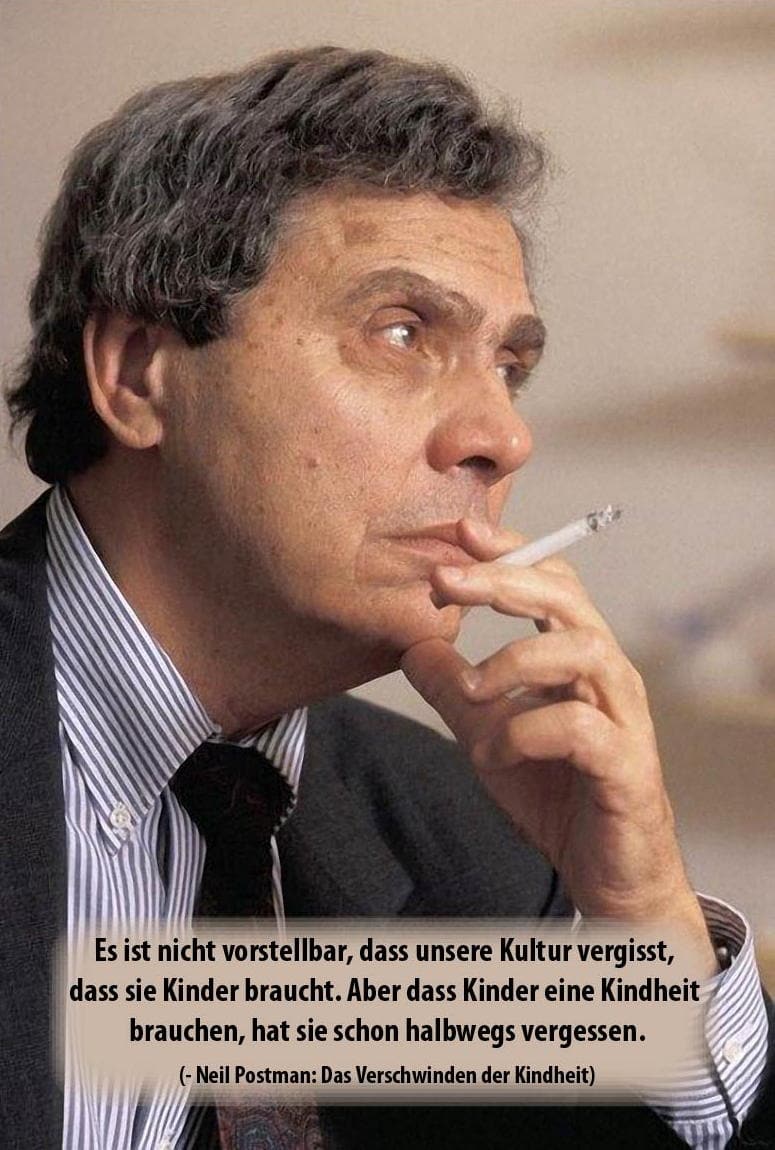 Ein authentischer Wille des Kindes muss nicht erst bewiesen werden. Er wird vorausgesetzt und muss ernst genommen werden. Genauso wie sich Erwachsene gekränkt fühlen, wenn ihre Wünsche ignoriert werden, so werden auch die Gefühle von Kindern verletzt, wenn man sie nicht beachtet [4].
Ein authentischer Wille des Kindes muss nicht erst bewiesen werden. Er wird vorausgesetzt und muss ernst genommen werden. Genauso wie sich Erwachsene gekränkt fühlen, wenn ihre Wünsche ignoriert werden, so werden auch die Gefühle von Kindern verletzt, wenn man sie nicht beachtet [4].
Ganz ähnlich werden auch die Interessen und die natürliche Neugierde von Schülern durch die Schulpflicht disqualifiziert. Die Unzulänglichkeit des zwangsverordneten Schulbesuchs wird besonders deutlich an der Unfähigkeit des Unterrichts, systematisch zwischen opportunistischen Strebern und ihren wirklich wissbegierigen Klassenkameraden zu unterscheiden.
Das hat nicht selten zur Folge, dass eigentlich lernfreudige Schüler aus Trotz und zur Abgrenzung ihre Anstrengung mindern und in Opposition zu den Lehrkräften treten. Zudem sind die Themen und Lernaufgaben des Unterrichts meist ein Abarbeiten des Curriculums und entstehen nicht organisch.
Die Schulpflicht macht die Schule daher zu einer disziplinarischen Anstalt im Geiste von Arbeitshäusern, auch wenn das im Einzelnen eine durchaus sanfte und wohlwollende Gestalt annehmen kann [6].
Macht man sich klar, dass Schulbildung, wie erwähnt, ein Recht ist, das nur deshalb zur Pflicht wird, weil es für seinen Träger nicht möglich ist, darauf zu verzichten, so wird die Absurdität dieser Situation noch offensichtlicher.
Es sollte selbstverständlich sein, dass es viel eher die Aufgabe des Staates ist, die Interessen der Lernenden zu berücksichtigen, die ihr Recht in Anspruch nehmen, als die Unterstützung von Zielen der Gesamtgesellschaft oder von Bedürfnissen der Unternehmen [3].
► Kinder gelten nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft
Dieses Spannungsverhältnis besteht seit den Anfängen der modernen Pädagogik. Die Schulpflicht, die sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts sukzessive aus den Notwendigkeiten der Industrialisierung und der demokratisierten Nationalstaatsbildung entwickelte, sollte sicherstellen, dass die Arbeiter und Bürger über die sozial erforderlichen Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen verfügen sowie minimal abstraktionsfähig und informiert sind [6].
Der Theologe und Pädagoge Peter Villaume (* 16. Juli 1746 in Berlin; † 11. Juni 1825 in Fyrendal auf Fünen) ging zu dieser Zeit sogar so weit zu sagen, dass „die Gesellschaft ein unwidersprechliches, heiliges Recht“ habe, dass die Menschen ihre Selbstvervollkommnung zugunsten ihrer standesbezogenen Brauchbarkeit opfern, um ein „Rad in einer großen Maschine“ zu werden, und es sei die Aufgabe der Erziehung, dies zu gewährleisten [7].
Heute steht hingegen offiziell die Mündigkeit der Schüler im Mittelpunkt der Bemühungen von Bildungseinrichtungen. De facto wird allerdings immer noch davon ausgegangen, dass Minderjährige nur zu akzeptablen Mitgliedern der Gesellschaft werden, wenn Erwachsene sie instruieren und kontrollieren.
Ihre Mitbestimmung beschränkt sich zumeist auf die formale Beteiligung im Rahmen der Schülermitverwaltung [1]. Inwieweit Kinder eine aktive Rolle in der Formulierung und Durchsetzung ihrer Rechte spielen können, wird jedoch kaum diskutiert. Es ist offensichtlich, dass die Entwicklung zu einer vollen Bürgerschaft von Kindern durch ihren marginalisierten Status unterminiert wird: Sie gelten heute, wie in früheren Zeiten Frauen und manche ethnischen Minderheiten, als ungeeignet, vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Folglich wird in der Literatur über Kinderrechte immer wieder betont, dass Kinder und Jugendliche ein tiefes Gefühl von Machtlosigkeit und Ausschluss empfinden.

Der Sozialwissenschaftler Manfred Liebel schlägt als Abhilfe vor, dass Kinder in der Schule nicht erst befähigt werden sollten, vollwertige Bürger zu werden, sondern dass der Lernprozess der Kinder darin besteht, sich ihrer Wichtigkeit und ihres eigenen Beitrags zum gesellschaftlichen Leben bewusst zu werden. Es geht um den Aufbau von Solidargemeinschaften und die Einforderung von Teilhabe und Mitverantwortung. Kinder müssen die Möglichkeit haben, eigene gruppenspezifische Interessen geltend machen zu können, auch wenn diese von den Erwartungen und Sichtweisen der Erwachsenen abweichen.
► Vergangene Bemühungen zur Demokratisierung der Schule sind gescheitert
 Diese Ansätze kamen mit der Idee der „Schulgemeinden“ in den 1920er Jahren bereits auf. In solchen pädagogischen Einrichtungen waren die Kinder und die Erzieher gleichberechtigt und es gab ein gemeinsames Entscheidungsrecht aller. Das Konzept war nicht als Spiel für die Kinder gedacht, in dem Demokratie bloß simuliert wird, sondern es gab ihnen die Möglichkeit, ihre eigenen Vorstellungen erfolgreich umzusetzen und solidarisches Handeln zu erleben.
Diese Ansätze kamen mit der Idee der „Schulgemeinden“ in den 1920er Jahren bereits auf. In solchen pädagogischen Einrichtungen waren die Kinder und die Erzieher gleichberechtigt und es gab ein gemeinsames Entscheidungsrecht aller. Das Konzept war nicht als Spiel für die Kinder gedacht, in dem Demokratie bloß simuliert wird, sondern es gab ihnen die Möglichkeit, ihre eigenen Vorstellungen erfolgreich umzusetzen und solidarisches Handeln zu erleben.
In den 1960er Jahren wurden diese Gedanken wieder von der Schülerbewegung aufgegriffen [8]. Diese heute weitgehend in Vergessenheit geratene Protestbewegung sah Schüler als rechtlose, unterdrückte und von undemokratischen Instanzen abhängige Gruppe.
Gefordert wurde: „Mitbestimmung in allen die Schüler bestimmenden Angelegenheiten, in Zeugnis- und Versetzungskonferenzen — in Fächerbewertung, Lehrplangestaltung und Lehrmittelauswahl“ [9].
Die Ansätze und Forderungen dieser und ähnlicher Bemühungen um eine Demokratisierung der Schule sind weitestgehend an der Macht des bestehenden Systems gescheitert. Ihre Motivation ist jedoch nachvollziehbar und auch im Hinblick auf die vielbeschworene Erziehung zur Mündigkeit erstrebenswert, denn es ist einfacher, in einer partizipativen Umgebung die Vorzüge eigenständigen Denkens zu begreifen als in einengenden Verhältnissen. Insbesondere da aus dem Recht auf Bildung durch den erwähnten sophistischen Kunstgriff eine Einschränkung der Freiheit abgeleitet wird, wäre es durchaus angebracht, ein Mitbestimmungsrecht derjenigen zu etablieren, die hiervon in erheblichem Maße betroffen sind.
Die Konsequenzen aus der juristischen Einordnung der Bildung als einem reinen Recht, und nicht einer Pflicht, sind enorm. Die Anerkennung dieser Schlussfolgerung würde der Leichtfertigkeit, mit der Regierungen und Schulen über Lehrpläne und Vorschriften entscheiden, ohne den Willen der Schüler zu berücksichtigen, ein Ende bereiten [3]. Das wäre eine begrüßenswerte Entwicklung und ein Schritt hin zu einer für alle Beteiligten respektvolleren und harmonischeren Beziehung.
Patrick Zimmerschied
Bitte auch die nachfolgenden Infos zu den drei Buchtipps und darunter die zahlreichen Lesetipps zu Kinderarmut, Schule, Bildung, Bildungssysteme, (Früh-)Konditionierung etc. beachten. -Helmut Schnug
___________
 Patrick Zimmerschied hat Philosophie und Politikwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt studiert und war dort Hilfskraft am Lehrstuhl für Wissenschaftsphilosophie. Seine Studienarbeiten wurden in diversen Büchern zitiert und in die Bibliothek des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit aufgenommen. Er ist als Übersetzer und Publizist tätig.
Patrick Zimmerschied hat Philosophie und Politikwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt studiert und war dort Hilfskraft am Lehrstuhl für Wissenschaftsphilosophie. Seine Studienarbeiten wurden in diversen Büchern zitiert und in die Bibliothek des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit aufgenommen. Er ist als Übersetzer und Publizist tätig.
Quellen und Anmerkungen:
[1] Maywald, Jörg 2016: 25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention. Der Kinderrechtsansatz in der Schule. In: Krappmann, Lothar/Petry, Christian (Hrsg.): Worauf Kinder und Jugendliche ein Recht haben. Kinderrechte, Demokratie und Schule: Ein Manifest. Schwalbach/Ts.: Debus Pädagogik Verlag/Wochenschau Verlag, 57-69.
[2] Restriktives Recht. Jürgen Amendt über Inklusion und Schulpflicht, Sept. 2017, nd-aktuell >> weiter.
[3] Bildung - Ein Pflichtrecht? Eine grundlegende Spannung innerhalb eines Grundrechts Von José-Luis Gaviria, tandfonline.com >> weiter. (englisch!!)
[4] Dr. phil Kira Amman 2020: (studierte Erziehungswissenschaft und Psychologie) »Kinderrechte und Bildsamkeit. Ein kritisches Plädoyer aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive.« Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
[5] Göppel, Rolf 2011: Schule und Erziehung — Ein kompliziertes Verhältnis. In: Göppel, Rolf/Rihm, Thomas/Strittmatter-Haubold, Veronika (Hrsg.): Muss — kann — darf die Schule erziehen? Heidelberg: Mattes Verlag, 9-17.
[6] Oevermann, Ulrich 2003: Brauchen wir heute noch eine gesetzliche Schulpflicht und welches wären die Vorzüge ihrer Abschaffung? In: Pädagogische Korrespondenz, 2003, 30, 54-70.
[7] Helsper, Werner 2004: Pädagogisches Handeln in den Antinomien der Moderne. In: Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft. Einführungskurs Erziehungswissenschaft I. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 15-34.
[8] Liebel, Manfred 2007: Bürgerschaft von unten — Kinderrechte und soziale Bewegungen von Kindern. In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 2(1), 83-99. >> weiter.
[9] Schildt, Axel 2003: Nachwuchs für die Rebellion — die Schülerbewegung der späten 60er Jahre. In: Reulecke, Jürgen (Hrsg.): Generationalität und Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 229-251.
Kira Ammann: Kinderrechte im Fokus der Bildsamkeit
Ein kritisches Plädoyer aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive
Verlag Velbrück Wissenschaft. 412 Seiten, broschiert, € 44,90 - 1. Auflage 2020,
ISBN print: 978-3-95832-227-1, ISBN online: 978-3-7489-1172-2.
Beschreibung:
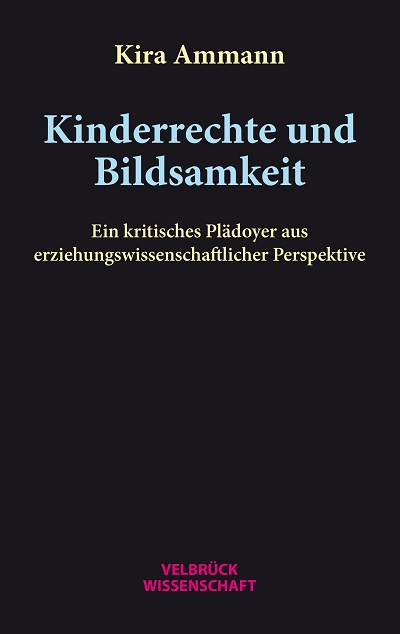 »Obwohl es die seit 1989 durch die UN-Kinderrechtskonvention normierte politisch-rechtliche Situation erwarten lassen würde, wurden Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Erziehung bislang noch nicht als Problem gesehen. Die vorliegende Untersuchung greift die Frage auf, wie der rechtliche Status der Heranwachsenden in der Erziehung gefasst werden kann und wirft damit ein neues Licht auf Debatten, die um Demokratiepädagogik und die Umsetzung von Kinderrechten in der pädagogischen Praxis geführt werden.
»Obwohl es die seit 1989 durch die UN-Kinderrechtskonvention normierte politisch-rechtliche Situation erwarten lassen würde, wurden Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Erziehung bislang noch nicht als Problem gesehen. Die vorliegende Untersuchung greift die Frage auf, wie der rechtliche Status der Heranwachsenden in der Erziehung gefasst werden kann und wirft damit ein neues Licht auf Debatten, die um Demokratiepädagogik und die Umsetzung von Kinderrechten in der pädagogischen Praxis geführt werden.
Mit disziplinübergreifenden Ausführungen legt die Autorin dar, was alles zu bedenken ist, wenn über Kind(er), Kindheit(en) und Kinderrechte gesprochen wird und was zukünftig in den interdisziplinären und öffentlichen Diskussionen berücksichtigt werden sollte. Anhand einer historischen Rekonstruktion der gesamten Konventionsgeschichte zeigt sie auf, wie es überhaupt dazu kam, dass heute von Kinderrechten gesprochen wird und inwiefern die Bildsamkeit des Menschen eine neue Perspektive auf das Verhältnis von Erziehung und Recht einzunehmen erlaubt.«
Kira Ammann, Dr. phil., studierte Erziehungswissenschaft und Psychologie und wurde 2019 promoviert. Sie ist am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Bern in der Abteilung Allgemeine und Historische Erziehungswissenschaft als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Forschung und Lehre tätig. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören Kinderrechte, erziehungswissenschaftliche Kindheitsforschung und die Frage nach dem Kind als Subjekt im Verhältnis von Erziehung und Recht.
Der Verlag Velbrück Wissenschaft wurde im Herbst 1999 mit dem Vorhaben gegründet, Werke aus dem breiten Spektrum der Soziologie, der Philosophie, der Kultur- und Geisteswissenschaften in den Mittelpunkt des Verlagsprogramms zu stellen. Seitdem hat sich der Velbrück Wissenschaft zu einem der renommiertesten deutschsprachigen Fachverlage für Theorie entwickelt. Die Publikationen sind Ergebnisse spezialisierter Forschungen, die Themenbereiche verbindet ihre theoretische Orientierung und ihre Anschlussfähigkeit über Disziplingrenzen hinweg. >> weiter.
Titelei/Inhaltsverzeichnis . . . . . . . Seite 1–13
1. Einleitung . . . . . . . Seite 14–17
2. Pädagogisches Sprechen über Kinderrechte? . . . . . . . Seite 18–46
2.1 Forschungs(gegen)stand und methodisches Vorgehen
2.2 Bildsamkeit – eine neue Perspektive?
2.3 Aufbau der Arbeit
3. Kinderrechte – ein Problem? . . . . . . . Seite 47–101
3.1 Kind, Kindheit oder the changing image of the child
3.2 Recht
3.3 Menschenrechte
3.4 Kinderrechte
4. Die Kinderrechtskonvention . . . . . . . Seite 102–242
4.1 Die Entstehung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes
4.2 Umsetzung und Monitoring
4.3 Ausblick
4.4 Kinderrechte in der Schweiz
5. Ein pädagogischer Kommentar . . . . . . . Seite 243–269
5.1 Kommentierung ausgewählter Artikel
5.2 Bildsamkeit und Recht
6. Zum Schluss . . . . . . . Seite 270–281
6.1 Beantwortung der Fragestellungen
6.2 Kritische Reflexion
6.3 Menschenrechtsbildung als praktische Konsequenz
Literaturverzeichnis . . . . . . . Seite 282–341
Rechtssammlung . . . . . . . Seite 342–401
Sachverzeichnis . . . . . . . Seite 402–412
► Quelle des Inhaltsverzeichnisses: Velbrueck-Verlagsseite velbrueck.de . Die Verwendung dieses Inhaltsverzeichnisses im Kritischen-Netzwerk erfolgt aus nicht-kommerziellem, aber journalistisch-redaktionellem Zweck mit dem Ziel, möglichst zahlreiche (Kauf-)Interessenten für das Buch zu erreichen. Der Betreiber des KN zieht daraus keinen finanziellen Nutzen! Die Rechte verbleiben selbstverständlich beim Verlag! Copyright ©️ Velbrück Wissenschaft.
https://www.velbrueck.de/Programm/Kinderrechte-und-Bildsamkeit.html
https://www.velbrueck.de/out/media/Ammann_Inhalt.pdf
Velbrück GmbH Bücher & Medien | Meckenheimer Straße 47 | 53919 Weilerswist-Metternich
Telefon: 0049 (0) 2254/83 603 0
Adultismus: Die Macht der Erwachsenen über die Kinder. Eine kritische Einführung.
Von Manfred Liebel und Philip Meade. Verlag Bertz + Fischer, Januar 2023,
Taschenbuch 440 Seiten, 13 Fotos, ISBN 978-3-86505-768-6, Preis 19,00 EUR.
Beschreibung:
 »Rassismus und Sexismus sind als Herrschaftsverhältnisse und Formen der Diskriminierung ebenso allgegenwärtig wie (formal) geächtet. Wie aber verhält es sich mit der kaum thematisierten Macht, der junge Menschen unterworfen sind?
»Rassismus und Sexismus sind als Herrschaftsverhältnisse und Formen der Diskriminierung ebenso allgegenwärtig wie (formal) geächtet. Wie aber verhält es sich mit der kaum thematisierten Macht, der junge Menschen unterworfen sind?
Kinder und Jugendliche erleben Adultismus auf vielfältige Weise, als . .
Geringschätzung, Missachtung, Entwürdigung, Entwertung, Unterstellung, Stigmatisierung, Vereinnahmung, Überwältigung, Fremdbestimmung, Unterwerfung, Benachteiligung oder Bestrafung. Bei manchen führt Adultismus zu Unsicherheit und Selbstentwertung, bei anderen zu Frustration und Widerstand. Wiederum andere resignieren, verstummen oder geben den erlebten Schmerz an Schwächere weiter.
Adultismus versteckt sich häufig sogar hinter Handlungen und Maßnahmen, die vorgeben, dem Schutz junger Menschen zu dienen. Er ist in fast allen Gesellschaften so alltäglich, dass er selten als Problem wahrgenommen wird. Auch in den Wissenschaften ist er bisher kaum untersucht worden.
Die Autoren blicken auf Adultismus als Diskriminierungsachse, aber auch als strukturelles Machtverhältnis, das sich etwa in Institutionen, Raumgestaltung oder Politik eingebrannt hat. Sie zeigen mit vielen Beispielen, in welchen Formen er auftritt und das Zusammenleben zwischen jungen und älteren Menschen beeinflusst. Sie erklären, wie er zustande kommt und sich immer wieder erneuert. Sie zeigen aber auch Wege auf, wie ihm der Boden entzogen werden kann, durch Erwachsene ebenso wie durch Kinder und Jugendliche selbst, im Privaten und Beruflichen wie im Politischen.
Die Autoren verstehen ihr Buch als eine Anregung zum Handeln, für eine Gesellschaft, in der nicht länger Mächtige über Ohnmächtige herrschen, in der junge Menschen und zukünftige Generationen zu ihrem Recht kommen.« (Verlagstext)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort . . . . . . 9
I. Was ist Adultismus? Eine erste Annäherung . . . . . . 13
Wie Adultismus erlebt wird . . . . . . 13
Die Alltäglichkeit des Adultismus . . . . . . 15
Wie verstehen wir Adultismus? . . . . . . 21
Deutungen des Adultismus . . . . . . 23
Die Vorläufer der Adultismuskritik und ein Überblick zur Forschung . . . . . . 24
Verwandte Begriffe und konzeptionelle Erweiterungen . . . . . . 29
Vorteile und Fallstricke des Etikettierens . . . . . . 34
Intersektionale Perspektive . . . . . . 36
Mangelndes Bewusstsein für Adultismus . . . . . . 37
Der historische Kontext . . . . . . 40
II. Adultismus in gesellschaftlichen Praxen . . . . . . 43
Kurze Vorbemerkung . . . . . . 43
Soziale Unterordnung junger Menschen in früheren Epochen und nicht-bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften . . . . . . 44
Unterdrückung von Kindern in »antiken Hochkulturen« bis zureuropäischen Neuzeit . . . . . . 47
Gewalt und Diskriminierung gegen Kinder im Kolonialisierungsprozess . . . . . . 53
Gewalt und Diskriminierung gegen Kinder in der postkolonialen Epoche . . . . . . 56
Egalitäre Altersordnungen in indigenen Gemeinschaften . . . . . . 59
Institutionelle Grundpfeiler des Adultismus in zeitgenössischenbürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften . . . . . . 64
Familie als Keimzelle des Adultismus . . . . . . 64
Schule als Hort des Adultismus . . . . . . 76
Recht und Politik als Manifestation des Adultismus . . . . . . 86
Sechs Bereiche adultistischer Diskriminierung junger Menschen . . . . . . 95
Sanktionierung nichtkonformen Verhaltens . . . . . . 96
Eingrenzender und paternalistischer Kinderschutz . . . . . . 102
Beschränkter Zugang zu Ressourcen . . . . . . 107
Herstellung von Normativität . . . . . . 115
Ausbeutung und Instrumentalisierung . . . . . . 131
Generationale Diskriminierung . . . . . . 140
III. Bausteine einer kritischen Theorie des Adultismus . . . . . . 147
Zum Stand der Theorie . . . . . . 147
Adultismus als Diskriminierungsform . . . . . . 148
Macht als Grundlage des Adultismus . . . . . . 154
Wirkungen und Rückwirkungen des Adultismus . . . . . . 162
Voraussetzungen und Entwicklung des Adultismus . . . . . . 169
Adultismus in der rechts- und moralphilosophischen Debatte über Kinderrechte . . . . . . 177
Adultismus unter Rechtfertigungsdruck . . . . . . 188
Agency junger Menschen als Kritik des Adultismus . . . . . . 199
Elemente einer Theorie des Kinder-Protagonismus . . . . . . 207
IV. Dem Adultismus entgegenwirken . . . . . . 221
Einleitung . . . . . . 221
Wer spricht hier für wen? . . . . . . 222
Kritisches Erwachsensein . . . . . . 225
Gibt es eine adultismuskritische (Sozial-)Pädagogik? . . . . . . 230
Das hierarchische Erziehungsverhältnis infrage stellen . . . . . . 231
Zur Geschichte adultismuskritischer pädagogischer Praxis . . . . . . 232
Subjektorientierte Zugänge zum Erwachsenen-Kind-Verhältnis . . . . . . 236
Versuche adultismuskritischer Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe . . . . . . 241
Kinderbücher gegen den kulturellen Adultismus . . . . . . 247
Gemeinsam gegen Adultismus in der Schule vorgehen . . . . . . 249
Aus dem politischen Schweigen herausfinden . . . . . . 256
Mit Kinderrechten dem Adultismus entgegenwirken . . . . . . 268
Wege zu einem nicht-adultistischen Kinderschutz . . . . . . 275
Politische Partizipation und Wahlrecht von Kindern . . . . . . 284
Für intergenerationale Gerechtigkeit . . . . . . 294
Dem Adultismus im städtischen Raum entgegenwirken . . . . . . 302
Wie junge Menschen den Adultismus infrage stellen . . . . . . 310
Selbstbefreiung und Widerstand . . . . . . 313
Kampf für eine bessere Gesellschaft . . . . . . 316
Überlebensstrategien . . . . . . 330
Fazit . . . . . . 340
V. Ausblick: Auf dem Weg zu einer adultismusfreien Gesellschaft . . . . . . 344
Anmerkungen . . . . . . 360
Literatur . . . . . . 380
► Quelle des Inhaltsverzeichnisses: Bertz + Fischer GbR, Berlin. Verlagsseite bertz-fischer.de/ . Die Verwendung dieses Inhaltsverzeichnisses im Kritischen-Netzwerk erfolgt aus nicht-kommerziellem, aber journalistisch-redaktionellem Zweck mit dem Ziel, möglichst zahlreiche (Kauf-)Interessenten für das Buch zu erreichen. Der Betreiber des KN zieht daraus keinen finanziellen Nutzen! Die Rechte verbleiben selbstverständlich beim Verlag! Copyright ©️ Bertz + Fischer GbR, Berlin.
Chronik des von Dieter Bertz (Politologe, Filmkritiker) 1995 gegründeten Verlages 'Bertz + Fischer Verlag GbR' in Berlin >> weiter.
https://www.bertz-fischer.de/adultismus
https://www.bertz-fischer.de/IMG/pdf/adultismus_inhalt.pdf
https://www.bertz-fischer.de/IMG/pdf/adultismus_vorwort.pdf
Bertz + Fischer GbR | Franz-Mehring-Platz 1 | D-10243 Berlin | mail[at]bertz-fischer.de | Tel.: [+49] 030 / 2978 3543
Unerhört. Kinder und Macht.
von Manfred Liebel, Verlag BELTZ JUVENTA in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel,
broschiert, 336 Seiten, ISBN: 978-3-7799-6152-9. Erschienen: 12.02.2020.
Preis 29,95 EUR. Auch als EBOOK/PDF für 27,99 EUR.
»Was würde aus der Welt, wenn Kinder an der Macht wären? Ein sinnloses Gedankenspiel? Eine schiefe Utopie? Kinder sind in ihrem Leben in vielerlei Hinsicht mit Macht konfrontiert. Im Buch geht es darum, die Handlungsmöglichkeiten von Kindern zu erkunden. Mit Beispielen aus verschiedenen Zeiten und Weltregionen wird gezeigt, was Kinder könnten, wenn man sie ließe. Und wenn sie die nötige Solidarität und Unterstützung derer fänden, die bisher noch Macht über sie haben. Es geht nicht darum, Macht über andere zu gewinnen, sondern darum, zu einem gleichgewichtigen Miteinander zu finden.« (-Verlagsmeldung)
Kurzer Auszug auf dem Vorwort:
 »Kinder und Macht – das Thema beschäftigt mich, seit ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite und forsche.
»Kinder und Macht – das Thema beschäftigt mich, seit ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite und forsche.
Als ich vor nunmehr 50 Jahren gemeinsam mit Franz Wellendorf eine Untersuchung zur Schülerbewegung in Deutschland machte und wir das daraus hervorgegangene Buch Schülerselbstbefreiung nannten (Liebel & Wellendorf 1969), standen Fragen der Macht bereits im Zentrum. Aber es dauerte Jahre, bis ich mich intensiver dem Thema widmete. Dies geschah insbesondere in meinen Studien zu Kinderrechten. Immer wieder stieß ich darauf, dass Kinderrechte zwar von allen, mit denen ich darüber sprach, bejubelt wurden, aber in der Praxis zeigte sich, dass sie vielfach an den Machtverhältnissen zwischen Kindern und Erwachsenen und denen sozialer Ungleichheit auf große Hindernisse stießen und vielfach totes Papier blieben. Rechte können dazu beitragen, an den bestehenden Machtverhältnissen zu rütteln, aber sie sind ein sperriges Instrument und tragen, in Gesetze gegossen, oft auch zu ihrer Konservierung bei.
Mit diesem Buch will ich dazu beitragen, besser zu verstehen, wie Macht von Kindern erlebt wird und wie sie damit umgehen. Macht bedeutet für sie meist Ohnmacht, aber es gibt auch Momente und Anzeichen, wo Kinder diese zumindest ein Stück weit hinter sich lassen. Solche Vorgänge lösen bei Erwachsenen und denen, die über einen Machtvorteil oder gar ein Machtmonopol verfügen, oft Ängste und Abwehrreaktionen aus. Sie befürchten, auf eigene Macht zu verzichten, könnte bei Kindern die gleichen Verhaltensweisen hervorbringen, die sie selbst gegenüber Kindern praktizieren.« (-Manfred Liebel, kurzer Auszug aus dem Vorwort).
Inhaltsverzeichnis >> weiter.
Leseprobe >> weiter.
https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/produkte/details/42850-unerhoert-kinder-und-macht.html
https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/inhaltsverzeichnisse/978-3-7799-6152-9.pdf
https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/leseproben/978-3-7799-6152-9.pdf
Über die Verlagsgruppe Beltz (Julius Beltz GmbH & Co. KG) Weinheim und Campus Verlag GmbH Frankfurt:
1841 ist das Gründungsjahr der Druckerei Julius Beltz im thüringischen Langensalza, nahe Erfurt. 1868 übernahm Julius Beltz (1819-1892) den Verlag Adolph Büchting in Nordhausen. Daraus wurde das »Verlagsgeschäft Julius Beltz«, ein Verlag für Lehrbücher mit regionaler Verbreitung. Heute ist der Verlag in den Themenbereichen Kinder- und Jugendbuch, Pädagogik und Erziehungswissenschaft, Training, Coaching und Beratung, Sachbuch/Ratgeber und Psychologie tätig. Seit 1974 bringt der Verlag zudem das Monatsmagazin Psychologie Heute heraus. [..]
Bei Beltz Juventa steht das Soziale im Fokus. Der Verlagsbereich ist in den Gebieten Bildung und Erziehung, Weiterbildung, Sozialwissenschaften, Pädagogik und Psychologie tätig. Das Programm umfasst wissenschaftliche Fachpublikationen und 18 Fachzeitschriften inkl. dem Sozialmagazin. Als Partner von wissenschaftlichen Instituten, Stiftungen und Bibliotheken platzieren wir erfolgreich Open Access Veröffentlichungen. Das Sachbuch-Programm bietet Sachbücher und Ratgeber für die Bereiche Baby und Kleinkind, Kindheit, Jugend, Eltern, Familie, Bildung, Schule, Psychologie an. >> weiter.
Verlagsgruppe Beltz - Julius Beltz GmbH & Co. KG, Werderstr. 10, 69 469 Weinheim, Telefon: 0049-6201-6007-0.
E-Mail: info(at)beltz.de - Internet: www.beltz.de
Die Verwendung dieser Texte und des Buchcovers im Kritischen-Netzwerk erfolgt aus nicht-kommerziellem, aber journalistisch-redaktionellem Zweck mit dem Ziel, möglichst zahlreiche (Kauf-)Interessenten für das Buch zu erreichen. Der Betreiber des KN zieht daraus keinen finanziellen Nutzen! Die Rechte verbleiben selbstverständlich beim Verlag! Copyright ©️ Verlagsgruppe Beltz (Julius Beltz GmbH & Co. KG) Weinheim.
Lesetipps zu Kinderarmut, Schule, Bildung, Bildungssysteme, (Früh-)Konditionierung etc.
 »Das brutale Fortschreiten der Entmündigung. Untertanen – im digitalen Zeitalter
»Das brutale Fortschreiten der Entmündigung. Untertanen – im digitalen Zeitalter
Das Digizän, die Epoche der Künstlichen Intelligenz: Wenn Kollektive zeitversetzt lernen, hat dies skurrile Situationen zur Folge. Während in den skandinavischen Ländern, die ihrerseits Pioniere bei der Digitalisierung des Schulunterrichts waren, rigoros die digitalen Hilfsmittel aus den Klassenzimmern entfernen und die großen Tycoone aus dem Silicon-Valley ihren Nachwuchs auf Schulen schicken, die mit ihrer analogen Vorgehensweise werben, hatten wir hier jüngst eine Bund-Länder-Konferenz zu protokollieren, in der die Digitalisierung der Schulen mit einer neuen Offensive bedacht werden sollte.
Länder mit hinreichender Erfahrung in der Gestaltung des Unterrichts unter digitalen Vorzeichen und Eliten, die ihre astronomischen Gewinne mit der Verbreitung digitaler Maschinen und Programme verdienen, wenden sich ab vom Trend, wenn es um die Ausbildung und Erziehung des Nachwuchses geht.
Ausgerechnet hier in Deutschland, wo man sich auf eine hohe Schule der Geistigkeit beruft, kann die Unterwerfung des jungen Verstandes nicht schnell genug voran gehen. Zudem ist der Ausdruck „schnell“ in diesem Kontext eine heillose Verharmlosung des Schneckentempos auf dem Terrain der Innovation«. Von Gerhard Mersmann | Forum-M7.com, im KN am 16. Dezember 2024 >> weiter.
 »Kein Interesse am Kindeswohl durch Bildungskahlschlag
»Kein Interesse am Kindeswohl durch Bildungskahlschlag
Kinder und Jugendliche zunehmend Opfer einer Verdummungskampagne. Piepegalpakt 2.0: Eine Runde digitaler Antibildung ist nicht genu. Schulische Leistungen werden kontinuierlich schlechter.
Der „Digitalpakt Schule“ war gestern. Deshalb braucht es schleunigst ein Anschlussprogramm, finden nicht nur IT-Industrielle und -Lobbyisten, sondern auch die hiesigen Gewerkschaften. Dass bisher so technikverliebte Länder wie Dänemark und Schweden die Flucht zurück zum Analogen ergreifen, um das Klassenzimmer wieder zum Bildungsraum zu machen, stört sie nicht, so wenig wie ein allgemeines Schulleistungsniveau im freien Fall. Bleibt nur die Hoffnung auf Gegenwehr durch Eltern, Lehrer und vielleicht ja sogar die größten Leidtragenden – die Kinder. Und darauf, dass die Politik für das Quatschprojekt kein Geld zusammenkratzt«. Von Ralf Wurzbacher | NachDenkSeiten, im KN am 20. Mai 2024 >> weiter.
 »Das Ende einer Illusion: Skandinavien nimmt Abstand von Schul-Digitalisierung. Im Frühjahr 2023 kündigte die schwedische Regierung an, die Digitalisierung im Schulunterricht zurückzufahren, was zu so mancher “Verstimmung” führte. Wie so oft, zog die norwegische Regierung im Herbst letzten Jahres nach (TKP hat berichtet) und kam zu ähnlichen Ergebnissen. Nun erschien kürzlich noch ein weiterer Hinweis zu dem dritten “Vorreiter” in Sachen Digitalisierung, Finnland, wo man auf der Sekundärstufe ebenso “vor einem Scherbenhaufen” steht.
»Das Ende einer Illusion: Skandinavien nimmt Abstand von Schul-Digitalisierung. Im Frühjahr 2023 kündigte die schwedische Regierung an, die Digitalisierung im Schulunterricht zurückzufahren, was zu so mancher “Verstimmung” führte. Wie so oft, zog die norwegische Regierung im Herbst letzten Jahres nach (TKP hat berichtet) und kam zu ähnlichen Ergebnissen. Nun erschien kürzlich noch ein weiterer Hinweis zu dem dritten “Vorreiter” in Sachen Digitalisierung, Finnland, wo man auf der Sekundärstufe ebenso “vor einem Scherbenhaufen” steht.
Skandinavien gilt in vielfacher Hinsicht als eine Art “Extremvorbild” für viele Themen, die in Mitteleuropa von Politik, “Experten™” und Leitmedien beklagt werden. Vielfach aber sind die Realitäten durchaus “anders” als man sich dies aus der Ferne vorstellt, und auch “Fact Finding”-Missionen wie von einer Abteilung der österreichischen (vom Oligarchen Hans-Peter Haselsteiner finanzierten “liberalen” Klein-) Partei NEOS letztes Jahr unternommen zeitigen oft ausgesprochen widersprüchliche wie -sinnige “Lernerfolge”«. Von von Assoc. Prof. Dr. Stephan Sander-Faes, tkp.at, 05. Januar 2024 >> weiter.
 »Fördern unsere Schulen den demokratischen Geist? Schulen funktionieren nicht so, wie es in den Schulgesetzen eigentlich vorgesehen ist: Sie fördern nicht kritisches Denken und einen demokratischen Geist, sondern Konformismus und einseitig ausgerichtete Weltbilder. Das ist in komprimierter Form die Kritik eines Gymnasiallehrers, der das getan hat, was in einer Demokratie eigentlich selbstverständlich sein sollte:
»Fördern unsere Schulen den demokratischen Geist? Schulen funktionieren nicht so, wie es in den Schulgesetzen eigentlich vorgesehen ist: Sie fördern nicht kritisches Denken und einen demokratischen Geist, sondern Konformismus und einseitig ausgerichtete Weltbilder. Das ist in komprimierter Form die Kritik eines Gymnasiallehrers, der das getan hat, was in einer Demokratie eigentlich selbstverständlich sein sollte:
Er übte Kritik an den Verhältnissen an seiner Schule, was ihm sehr viel Ärger eingebracht hat. Deshalb schrieb er sein Buch „Mensch, lern das und frag nicht!“, in dem er deutsche Schulbücher und den Schulunterricht an sich analysiert. Dies war nur möglich, weil er sein Buch unter einem Pseudonym (Hauke Arach) veröffentlichte. NDS-Autor Udo Brandes im Interview mit dem Pädagogen zu seinem Buch und seiner Kritik am Schulunterricht an deutschen Schulen.« >> NDS-Artikel vom 27. Dezember, im KN am 29. Dezember 2023 >> weiter.
 »Marode Bildungspolitik zulasten des Leistungsniveaus. Die PISA-Ergebnisse zeigen ein Versagen mit Ansage.
»Marode Bildungspolitik zulasten des Leistungsniveaus. Die PISA-Ergebnisse zeigen ein Versagen mit Ansage.
Allenthalben wird erstaunt bis schockiert auf die Ergebnisse der PISA-Studie reagiert. Wer aber die Entwicklung der letzten Jahrzehnte in der Bildungspolitik beobachtet hat, wundert sich eher, dass sich dieses Versagen nicht schon früher manifestiert hat.
Schon vor 50 Jahren konnte beobachtet werden, dass eine höhere Abiturientenquote immer mit Abstrichen an der Qualität des Abiturniveaus verbunden ist. Wer zum Beispiel in Bayern am Abitur zu scheitern drohte, der konnte nach Hessen oder noch besser nach Bremen wechseln, um dort sein „Zeugnis der Reife“ ohne weitere Probleme zu erhalten.
Ich hatte Klassenkameraden, die ohne diese Not in diese Bundesländer wechselten und dort sogar eine Klasse überspringen konnten. Diese Beobachtung lässt den Schluß zu, dass es in jeder Gesellschaft eine gewisse Menge an begabten gibt, die zu einem ordentlichen Abitur geeignet sind. Will man also die Quote an Abiturienten erhöhen, ist das nur möglich, indem man Abstriche an den Anforderungen macht. Bayern hatte immer eine verhältnismäßig kleine Abiturientenquote und Bremen eine hohe. Die Qualität des Abiturs war reziprok.« Von Peter Haisenko, im KN am 28. Dezember 2023 >> weiter.
 »Der Intelligenzkiller im Kinderzimmer. Babys ausgiebig mit Handys spielen zu lassen kann desaströse Auswirkungen auf spätere kognitive Leistungen haben. Wissenschaft, Medizin und Beratungsinstitutionen stemmen sich zu wenig dagegen.
»Der Intelligenzkiller im Kinderzimmer. Babys ausgiebig mit Handys spielen zu lassen kann desaströse Auswirkungen auf spätere kognitive Leistungen haben. Wissenschaft, Medizin und Beratungsinstitutionen stemmen sich zu wenig dagegen.
Seit einigen Jahren gibt es immer mehr 5. Klässler, die den 10-er Übergang nicht beherrschen, also nicht in einem Atemzug sagen können, wie viel 9+5 ergibt. Oder 6.-Klässler, die beim Einmaleins abzählen. Meistens handelt sich dabei um Kinder aus bildungsfernen Haushalten. Für mich als Primarlehrerin ist eindeutig klar, was dahintersteckt: Das Smartphone. Beziehungsweise all die Primärerfahrungen, die es behindert, also Bälle rollen, Steinchen schmeissen, Flaschen aufschrauben.
Die Wissenschaft spricht von Vorläuferkompetenzen, die vorhanden sein müssen, damit sich mathematisches Können überhaupt einstellen kann. Das fängt beim Aufschichten von Bauklötzchen oder Legosteinen an und geht bis zu den Gesellschaftsspielen. Aber auch Springen, Laufen, Drehen sind Raum- und damit mathematische Erfahrungen. All dies fehlt, wenn Spiele und Bewegung im Smartphone zusammenschmelzen.« Von Samia Guemei, Zeitpunkt.ch, 06. November 2023 >> weiter.
 »Die deutsche Schulbildung rutscht in die Mittelmäßigkeit. Mensch, lern das und frag nicht! In den Schulen der BRD wird schon immer „politisch korrekt“ gelehrt. Was nicht sein durfte, durfte auch nicht angezweifelt werden. Während der 1990er Jahre hat sich diese unwissenschaftliche Indoktrinierung kontinuierlich weiter entwickelt. Immer neue Lehrbücher mit handverlesenen Inhalten haben die gymnasiale Bildung auf ein Niveau des stumpfen Auswendiglernens reduziert. Ein wissenschaftsähnliches Hinterfragen von Inhalten ist nicht vorgesehen.
»Die deutsche Schulbildung rutscht in die Mittelmäßigkeit. Mensch, lern das und frag nicht! In den Schulen der BRD wird schon immer „politisch korrekt“ gelehrt. Was nicht sein durfte, durfte auch nicht angezweifelt werden. Während der 1990er Jahre hat sich diese unwissenschaftliche Indoktrinierung kontinuierlich weiter entwickelt. Immer neue Lehrbücher mit handverlesenen Inhalten haben die gymnasiale Bildung auf ein Niveau des stumpfen Auswendiglernens reduziert. Ein wissenschaftsähnliches Hinterfragen von Inhalten ist nicht vorgesehen.
Ich erzähle ein Beispiel aus meiner Schulzeit in den 1960er Jahren. 1964 fand am Münchner Oberlandesgericht ein Prozess statt. Die Witwe eines SS-Offiziers hatte den „Spiegel“ auf Unterlassung verklagt. Er sollte nicht mehr behaupten dürfen, dass es die SS war, die die polnischen Offiziere in Katyn ermordet hat. Mein Vater war als Dolmetscher zu diesem Prozess berufen, für die russische und ukrainische Sprache. Dokumente mussten übersetzt werden werden. Dieser Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber weil mein Vater der Dolmetscher war, konnte ich als Teenager den Prozess und seinen Ausgang beobachten. Die Witwe des SS-Offiziers hat diesen Prozess mit wehenden Fahnen gewonnen.« Von Peter Haisenko, im KN am 01. November 2023 >> weiter.
 »Tablets sollten von Geburt an Teil der Welt eines Babys sein. Handys in Kinderhand – „Erziehung“ zur Denkschwäche. Die Bilder häufen sich: Eine Familie am Nachbartisch im Restaurant unterhält sich, die 7-jährige Tochter und sogar der 3-jährige Benjamin sind mit eigenen Handys ruhiggestellt. Während des Gesprächs sieht man auch den Vater und den 18-jährigen Neffen zwischendurch ständig wie zwanghaft ihr Handy aus der Tasche ziehen und herunterscrollen.
»Tablets sollten von Geburt an Teil der Welt eines Babys sein. Handys in Kinderhand – „Erziehung“ zur Denkschwäche. Die Bilder häufen sich: Eine Familie am Nachbartisch im Restaurant unterhält sich, die 7-jährige Tochter und sogar der 3-jährige Benjamin sind mit eigenen Handys ruhiggestellt. Während des Gesprächs sieht man auch den Vater und den 18-jährigen Neffen zwischendurch ständig wie zwanghaft ihr Handy aus der Tasche ziehen und herunterscrollen.
Auf dem Spielplatz im Park hängen die Schaukeln unberührt, denn die Kinder sitzen oder stehen herum und sind ganz in ihre Handys oder Tablets vergraben. – Mit diesen Phänomenen ist eine Fülle von schweren pädagogischen und sozialen Problemen verbunden, von denen nachfolgend nur einem näher nachgegangen werden soll.« Von Herbert Ludwig, Fassadenkratzer, im KN am 30. Oktober 2023 >> weiter.
 »Die BRD rutscht bei den „PISA-Rängen“ immer weiter ab. Ganztagsschulen: Kultusminister wollen mehr Qualität. Die Qualität der Schulbildung bewegt sich auf ein gefährlich niedriges Niveau zu. Da kommt die Meldung zur rechten Zeit, dass die Kultusminister mehr Qualität in den Ganztagsschulen fordern. Doch wo liegen da die Schwerpunkte?
»Die BRD rutscht bei den „PISA-Rängen“ immer weiter ab. Ganztagsschulen: Kultusminister wollen mehr Qualität. Die Qualität der Schulbildung bewegt sich auf ein gefährlich niedriges Niveau zu. Da kommt die Meldung zur rechten Zeit, dass die Kultusminister mehr Qualität in den Ganztagsschulen fordern. Doch wo liegen da die Schwerpunkte?
Die Pressemeldung zur Kultusministerkonferenz war kurz und sie zeigt auf, dass es einen echten Reformwillen nicht gibt. Zwölf „Empfehlungen“ werden diskutiert und sie sollen beschlossen werden. Sollen... Bezeichnenderweise wird nur über einen dieser Punkte berichtet und der hat mit Bildung als solcher nichts zu tun.« Von Peter Haisenko, im KN am 16. Oktober 2023 >> weiter.
 »Die „finstere Agenda“ von Big Tech, die Kinder an die Technik fesselt. Da sich Babys mit einem Tablet in der Hand entwickeln, ist der nächste logische Schritt, angeblich zur Bequemlichkeit aller, die Implantation eines Mobilfunkgeräts – ja, eines Mini-Handys – in den Körper unserer Kinder.« Artikel auf UNCUT.news, 20. September 2023 >> weiter.
»Die „finstere Agenda“ von Big Tech, die Kinder an die Technik fesselt. Da sich Babys mit einem Tablet in der Hand entwickeln, ist der nächste logische Schritt, angeblich zur Bequemlichkeit aller, die Implantation eines Mobilfunkgeräts – ja, eines Mini-Handys – in den Körper unserer Kinder.« Artikel auf UNCUT.news, 20. September 2023 >> weiter.
 »Es steht zappenduster um die Bildungsqualität. Sackgasse Klassenzimmer. Die vormalige Bildungsnation Deutschland wird von immer mehr aufstrebenden Ländern überholt — statt das Problem im Kern zu lösen, wird nur Geld zugeschossen.
»Es steht zappenduster um die Bildungsqualität. Sackgasse Klassenzimmer. Die vormalige Bildungsnation Deutschland wird von immer mehr aufstrebenden Ländern überholt — statt das Problem im Kern zu lösen, wird nur Geld zugeschossen.
Die Zukunft eines Landes spiegelt sich in der gegenwärtigen Bildungsqualität. Und da sieht es in Deutschland zappenduster aus. Der Anteil der von Burnout bedrohten Lehrkräfte ist alarmierend. Der Ausweg, den viele Lehrerinnen und Lehrer gewählt haben, durch Teilzeit wenigstens etwas Druck aus dem psychischen Kessel zu lassen, wird seitens der Bildungspolitik immer weiter verbaut.« Von Roberto J. De Lapuente | MANOVA (vormals RUBIKON), im KN am 18. April 2023 >> weiter.
 »Unsere Schulen müssen demokratisiert werden. Unsere weitestgehend nutzlosen Bildungsinstitutionen. Ein pädagogisches Paradoxon. Der Erziehung zu einem mündigen Bürger liegt ein fundamentales Problem zugrunde, auf das bereits Immanuel Kant in seiner Abhandlung über Pädagogik verwiesen hat: „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ Auch über 200 Jahre nachdem er seine Schrift verfasst hat und Generationen von Philosophen und Erziehungswissenschaftlern nach ihm dieser Frage auf den Grund gegangen sind, haben es unsere Gesellschaft und ihre weitestgehend nutzlosen Bildungsinstitutionen nicht geschafft, all die Erkenntnisse vergangener Geistesgrößen in ein funktionierendes staatliches Schulsystem umzusetzen.« Von Patrick Zimmerschied | RUBIKON, im KN am 25. Februar 2023 >> weiter.
»Unsere Schulen müssen demokratisiert werden. Unsere weitestgehend nutzlosen Bildungsinstitutionen. Ein pädagogisches Paradoxon. Der Erziehung zu einem mündigen Bürger liegt ein fundamentales Problem zugrunde, auf das bereits Immanuel Kant in seiner Abhandlung über Pädagogik verwiesen hat: „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ Auch über 200 Jahre nachdem er seine Schrift verfasst hat und Generationen von Philosophen und Erziehungswissenschaftlern nach ihm dieser Frage auf den Grund gegangen sind, haben es unsere Gesellschaft und ihre weitestgehend nutzlosen Bildungsinstitutionen nicht geschafft, all die Erkenntnisse vergangener Geistesgrößen in ein funktionierendes staatliches Schulsystem umzusetzen.« Von Patrick Zimmerschied | RUBIKON, im KN am 25. Februar 2023 >> weiter.
 »Deutschland fehlen massenhaft Lehrkräfte: Das Land braucht aktuell bis zu 40.000 Lehrkräfte, in naher Zukunft wohl noch viel mehr. Es wird alles unternommen, jungen Menschen den Beruf zu verleiden. Da wird doch jeder frischgebackene Pädagoge mit Kusshand genommen – sollte man meinen. Dass dem nicht so sein muss, zeigt der Fall eines voll ausgebildeten Junglehrers mit Topabschluss und allerbesten Voraussetzungen, beruflich durchzustarten.« Von Ralf Wurzbacher | NDS, im KN am 17. Februar 2023 >> weiter.
»Deutschland fehlen massenhaft Lehrkräfte: Das Land braucht aktuell bis zu 40.000 Lehrkräfte, in naher Zukunft wohl noch viel mehr. Es wird alles unternommen, jungen Menschen den Beruf zu verleiden. Da wird doch jeder frischgebackene Pädagoge mit Kusshand genommen – sollte man meinen. Dass dem nicht so sein muss, zeigt der Fall eines voll ausgebildeten Junglehrers mit Topabschluss und allerbesten Voraussetzungen, beruflich durchzustarten.« Von Ralf Wurzbacher | NDS, im KN am 17. Februar 2023 >> weiter.
 »Grassierender Engpass bei Lehrern und Pädagogen: Die Lösungs-in-kompetenz der Kultusministerkonferenz. Mehrarbeit, größere Klassen, Hybridunterricht, Reaktivierung von pensionierten Lehrkräften, Einsatz von Quereinsteigern. Die „Empfehlungen“ einer Kommission der Landeskultusminister, um dem historischen Engpass bei Pädagogen zu begegnen, sorgen für Entsetzen bei Gewerkschaften und Bildungsverbänden. Das Gremium tischt so ziemlich alle Fehler der Vergangenheit als Rezept für die Zukunft auf. Die Therapie ist krank, macht krank und kann nur nach hinten losgehen.« Von Ralf Wurzbacher | NDS, im KN am 07. Februar 2023 >> weiter.
»Grassierender Engpass bei Lehrern und Pädagogen: Die Lösungs-in-kompetenz der Kultusministerkonferenz. Mehrarbeit, größere Klassen, Hybridunterricht, Reaktivierung von pensionierten Lehrkräften, Einsatz von Quereinsteigern. Die „Empfehlungen“ einer Kommission der Landeskultusminister, um dem historischen Engpass bei Pädagogen zu begegnen, sorgen für Entsetzen bei Gewerkschaften und Bildungsverbänden. Das Gremium tischt so ziemlich alle Fehler der Vergangenheit als Rezept für die Zukunft auf. Die Therapie ist krank, macht krank und kann nur nach hinten losgehen.« Von Ralf Wurzbacher | NDS, im KN am 07. Februar 2023 >> weiter.
 »Deutschland ist arm an Kindern, aber reich an armen Kindern. Jedes fünfte Kind arm? Jedes vierte? Egal, Panzer sind wichtiger. edes Jahr gibt es neue Zahlen zur Armut, die den alten gleichen, und immer wieder gibt es Berichte der Bertelsmann Stiftung dazu. Aber es ändert sich nichts, zumindest nicht zum Guten. Wenn es nächstes Jahr noch einen solchen Bericht geben sollte, sind noch mehr Kinder arm.« Von Dagmar Henn, im KN am 30. Januar 2023 >> weiter.
»Deutschland ist arm an Kindern, aber reich an armen Kindern. Jedes fünfte Kind arm? Jedes vierte? Egal, Panzer sind wichtiger. edes Jahr gibt es neue Zahlen zur Armut, die den alten gleichen, und immer wieder gibt es Berichte der Bertelsmann Stiftung dazu. Aber es ändert sich nichts, zumindest nicht zum Guten. Wenn es nächstes Jahr noch einen solchen Bericht geben sollte, sind noch mehr Kinder arm.« Von Dagmar Henn, im KN am 30. Januar 2023 >> weiter.
 »Der Akademikeranteil in der Bevölkerung ist zu hoch. Er lässt eine Gesellschaft in eine destruktive Eigendynamik abgleiten. Das akademische Übergewicht bringt die Gesellschaft ins Ungleichgewicht. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Anteil akademisch ausgebildeter Menschen in der Gesellschaft drastisch erhöht. Man kann es an der deutlich gestiegenen Anzahl Studierender sehen, die sich in Universitäten und Fachhochschulen um einen Abschluss bemühen, um für die höhere Laufbahn in Institutionen und Ministerien oder der Wirtschaft und den Medien bereit zu sein. Manche bleiben auf der Universität, um zu lehren oder Wissenschaft zu treiben; andere gehen in Unternehmen oder in staatliche Institutionen, um dort Karriere zu machen.
»Der Akademikeranteil in der Bevölkerung ist zu hoch. Er lässt eine Gesellschaft in eine destruktive Eigendynamik abgleiten. Das akademische Übergewicht bringt die Gesellschaft ins Ungleichgewicht. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Anteil akademisch ausgebildeter Menschen in der Gesellschaft drastisch erhöht. Man kann es an der deutlich gestiegenen Anzahl Studierender sehen, die sich in Universitäten und Fachhochschulen um einen Abschluss bemühen, um für die höhere Laufbahn in Institutionen und Ministerien oder der Wirtschaft und den Medien bereit zu sein. Manche bleiben auf der Universität, um zu lehren oder Wissenschaft zu treiben; andere gehen in Unternehmen oder in staatliche Institutionen, um dort Karriere zu machen.
Durch das hohe Angebot und die relativ geringe Nachfrage entsteht einerseits ein hoher Leistungsdruck, aber ebenso ein starker Anpassungswille. Hinzu kommt noch die mediale Ehrgeizpropaganda, nach der jeder seines Glückes Schmied sein soll. Man fragt sich: Wozu werden so viele Akademiker gebraucht?« Von Thomas Eblen | RUBIKON, im KN am 12. Januar 2023 >> weiter.
 »Schulen ohne persönlich anwesende Schüler und Lehrer. Schulen sind die Labore unserer Zukunft. Das Verblödungssystem.« Von Willy Meyer, im KN am 5. Oktober 2022 >> weiter.
»Schulen ohne persönlich anwesende Schüler und Lehrer. Schulen sind die Labore unserer Zukunft. Das Verblödungssystem.« Von Willy Meyer, im KN am 5. Oktober 2022 >> weiter.
 »Lehrermangel durch jahrzehntelange Fehlplanung. Bildungskahlschlag auf dem Rücken unserer Kinder und Jugendlichen. Sachsen-Anhalt probt die Vier-Tage-Woche, Nordrhein-Westfalen verschiebt Tausende Pädagogen auf fremdes Terrain und Sachsen setzt auf „planmäßigen Unterrichtsausfall“. Ein so nie dagewesener Lehrermangel treibt die seltsamsten Blüten und wird künftig doch nur der Normalfall sein. Es rächen sich jahrzehntelange Fehlplanung im Zeichen von Rotstift und Entstaatlichung und mit dem letzten Aufgebot an Amateurpaukern wird der neoliberalen Privatisierungslobby der Boden bereitet.« Von Ralf Wurzbacher | NDS, im KN am 28. September 2022 >> weiter.
»Lehrermangel durch jahrzehntelange Fehlplanung. Bildungskahlschlag auf dem Rücken unserer Kinder und Jugendlichen. Sachsen-Anhalt probt die Vier-Tage-Woche, Nordrhein-Westfalen verschiebt Tausende Pädagogen auf fremdes Terrain und Sachsen setzt auf „planmäßigen Unterrichtsausfall“. Ein so nie dagewesener Lehrermangel treibt die seltsamsten Blüten und wird künftig doch nur der Normalfall sein. Es rächen sich jahrzehntelange Fehlplanung im Zeichen von Rotstift und Entstaatlichung und mit dem letzten Aufgebot an Amateurpaukern wird der neoliberalen Privatisierungslobby der Boden bereitet.« Von Ralf Wurzbacher | NDS, im KN am 28. September 2022 >> weiter.
 »Entwicklungspsychologe Piaget: Die Theorie der Kognitiven Entwicklung. Über die Natur und Entwicklung menschlicher Intelligenz. Die Theorie der kognitiven Entwicklung nach dem Entwicklungspsychologen Piaget ist eine umfassende Theorie über die Natur und Entwicklung menschlicher Intelligenz. Die Theorie befasst sich mit der Natur von Wissen und Erkenntnis, mit deren Erwerb, Konstruktion und Gebrauch. Piagets Theorie ist hauptsächlich als Theorie kognitiver Entwicklungsstufen bekannt.
»Entwicklungspsychologe Piaget: Die Theorie der Kognitiven Entwicklung. Über die Natur und Entwicklung menschlicher Intelligenz. Die Theorie der kognitiven Entwicklung nach dem Entwicklungspsychologen Piaget ist eine umfassende Theorie über die Natur und Entwicklung menschlicher Intelligenz. Die Theorie befasst sich mit der Natur von Wissen und Erkenntnis, mit deren Erwerb, Konstruktion und Gebrauch. Piagets Theorie ist hauptsächlich als Theorie kognitiver Entwicklungsstufen bekannt.
Piaget glaubte, dass Kinder nicht wie ‚kleine Erwachsene‘ seien, die nur über weniger Wissen verfügten – Kinder dächten und sprächen grundsätzlich anders. Da Piaget davon ausging, dass Kinder über große kognitive Fähigkeiten verfügen, entwickelte er vier verschiedene Stufen der kognitiven Entwicklung, die er in Tests untersuchte.« Von Jonas Koblin | Sproutsschools - Sprouts Deutschland, im KN am 22. Februar 2022 >> weiter.
 »Die entwurzelte Generation: Eine Zustandsbeschreibung der heutigen Jugend. Allgegenwärtige Smartphone-Nutzung und die Omnipräsenz des Digitalen. Eine Jugend wächst heran, der die Freiheit fremd und das Denken zu anstrengend geworden ist und der man das Fühlen abtrainiert hat.
»Die entwurzelte Generation: Eine Zustandsbeschreibung der heutigen Jugend. Allgegenwärtige Smartphone-Nutzung und die Omnipräsenz des Digitalen. Eine Jugend wächst heran, der die Freiheit fremd und das Denken zu anstrengend geworden ist und der man das Fühlen abtrainiert hat.
„Die jungen Leute heutzutage ...“, hörte und hört man des Öfteren die Älteren lamentieren. Das Unverständnis über die nachfolgende Generation galt in der Vergangenheit ihrem rebellischen Unwesen. Seit einiger Zeit — so scheint es — hat sich der Generationenkonflikt in sein Gegenteil verkehrt. Weniger wird das Rebellentum der Jugend beklagt oder kritisiert als ihre Neigung zum Konformismus sowie der unkritischen Anpassung an all die Agenden, die multimedial durchgepeitscht werden. Sei es das Gendern hier, der Klimaschutz dort oder aktuell die totale Durchimpfung der Bevölkerung. Wie ein ungeschützter Rechner lässt sich das Betriebssystem der Jugend mit jedem beliebigen Programm bespielen. Was sind die tragenden Säulen dieser Entwicklung?« Von Nicolas Riedl | RUBIKON, im KN am 14. Oktober 2021 >> weiter.
 »Digitale Bildung. Frühe Medienkompetenz oder digitale Verdummung? Wie die Entwicklung der Kinder durch digitale Bildung schwer geschädigt wird. Ein breites System „Digitaler Bildung“, das den Lehrer überflüssig machen soll, wird in den Schulen vorangetrieben, da eine frühe Medienkompetenz erforderlich sei, um den Anschluss an die globale digitale Entwicklung nicht zu verpassen. Dabei werden jedoch die Bedingungen der verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes völlig außeracht gelassen – mit verheerenden Folgen.« von Herbert Ludwig, im KN am 9. Dezember 2019 >> weiter.
»Digitale Bildung. Frühe Medienkompetenz oder digitale Verdummung? Wie die Entwicklung der Kinder durch digitale Bildung schwer geschädigt wird. Ein breites System „Digitaler Bildung“, das den Lehrer überflüssig machen soll, wird in den Schulen vorangetrieben, da eine frühe Medienkompetenz erforderlich sei, um den Anschluss an die globale digitale Entwicklung nicht zu verpassen. Dabei werden jedoch die Bedingungen der verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes völlig außeracht gelassen – mit verheerenden Folgen.« von Herbert Ludwig, im KN am 9. Dezember 2019 >> weiter.
 »Digitale Verdummung – wie sie in der Schule veranlagt wird und in der Politik schon angekommen ist! In ungeheurem Maße werben einschlägige Wirtschaftsunternehmen für breite „Digitale Bildung“ in Kitas und Schulen. Und die Bundes- und Landesregierungen treiben mit einem „Digitalpakt“ intensiv die Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien voran, wofür der Bund über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Es bahnt sich eine technologische Neuausrichtung des Erziehungswesens an, eine weitgehende Übernahme des Unterrichtsgeschehens durch Computer-gesteuerte Bildungs-Einheiten und Programme – mit weitreichenden und verheerenden Folgen für die Entwicklung der Kinder.« Von Herbert Ludwig | Fassadenkratzer, 12. Juni 2019 >> weiter.
»Digitale Verdummung – wie sie in der Schule veranlagt wird und in der Politik schon angekommen ist! In ungeheurem Maße werben einschlägige Wirtschaftsunternehmen für breite „Digitale Bildung“ in Kitas und Schulen. Und die Bundes- und Landesregierungen treiben mit einem „Digitalpakt“ intensiv die Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien voran, wofür der Bund über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Es bahnt sich eine technologische Neuausrichtung des Erziehungswesens an, eine weitgehende Übernahme des Unterrichtsgeschehens durch Computer-gesteuerte Bildungs-Einheiten und Programme – mit weitreichenden und verheerenden Folgen für die Entwicklung der Kinder.« Von Herbert Ludwig | Fassadenkratzer, 12. Juni 2019 >> weiter.
 »Das Kind vor dem Bildschirm – Auswirkungen auf seine Entwicklung. Weithin ist die Vorstellung verbreitet, dass die Kinder nur kleine Erwachsene seien, gleichsam deren unvollständige Miniaturausgaben, die über die gleichen Fähigkeiten und Denkformen verfügten wie diese, graduell eben nur noch nicht so ausgebildet. Danach wird die Entwicklung als ein linearer Vorgang angesehen, der von Anfang bis Ende denselben Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten unterliege. Entwicklung bestünde praktisch in einer quantitativen Steigerung derselben Fähigkeiten. Daher müsse eine Fähigkeit, wie beispielsweise das intellektuelle, logische Denken, schon früh geübt werden, damit es dem Erwachsenen dann in bestmöglicher Weise zur Verfügung stünde.« Von Herbert Ludwig | Fassadenkratzer, 12. Dezember 2014 >> weiter.
»Das Kind vor dem Bildschirm – Auswirkungen auf seine Entwicklung. Weithin ist die Vorstellung verbreitet, dass die Kinder nur kleine Erwachsene seien, gleichsam deren unvollständige Miniaturausgaben, die über die gleichen Fähigkeiten und Denkformen verfügten wie diese, graduell eben nur noch nicht so ausgebildet. Danach wird die Entwicklung als ein linearer Vorgang angesehen, der von Anfang bis Ende denselben Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten unterliege. Entwicklung bestünde praktisch in einer quantitativen Steigerung derselben Fähigkeiten. Daher müsse eine Fähigkeit, wie beispielsweise das intellektuelle, logische Denken, schon früh geübt werden, damit es dem Erwachsenen dann in bestmöglicher Weise zur Verfügung stünde.« Von Herbert Ludwig | Fassadenkratzer, 12. Dezember 2014 >> weiter.
weitere interessante Artikel:
"Schulfrei: Vom Teilzeitgefängnis Schule zum Vollzeitgefängnis Familie? Es genügt nicht, Kinder „wegen Corona“ jetzt zuhause abzurichten — nötig wäre ein Paradigmenwechsel hin zu selbstbestimmtem Lernen." Von Bertrand Stern, im KN am 25. Mai 2021 >> weiter.
"Das Halbtagsschulsystem in Österreich konserviert eine Bildungsungleichheit. Halber Tag, doppelter Nachteil?" von Elke Larcher und Oliver Gruber / A&W blog, 21. September 2020, im KN am 25. Sept. 2020. >> weiter.
"OECD: Bildung auf einen Blick 2020 - OECD-INDIKATOREN". ("Education at a Glance 2020 - OECD Indicators") >> weiter. (PDF).
"Kinderarmut: Medien berichten zu oberflächlich und mit zu wenig Nachdruck" von Marcus Klöckner | NDS, 08. August 2020, am 10.08. im KN >> weiter.
"Maskenzwang im Unterricht: Ein bizarrer Plan. Für Schüler soll nun teils sogar im Unterricht eine Maskenpflicht gelten. Diese Pläne sind unverantwortlich und unwissenschaftlich." von Tobias Riegel | NDS, 05. August 2020. >> weiter.
"Die Ernüchterungsanstalt: Die Schule erstickt das Interesse für Poesie im Keim, indem sie Schüler zwingt, diese rational zu zergliedern." von Nicolas Riedl / RUBIKON, 26. April 2020, im KN 28. Juli 2020 >> weiter.
"Factsheet Kinderarmut in Deutschland" von Antje Funcke und Sarah Menne, Bertelsmann Stiftung - Juli 2020 >> weiter.
"Materielle Unterversorgung von Kindern" von Dr. Torsten Lietzmann und Dr. Claudia Wenzig, IAB und Bertelsmann Stiftung - Juli 2020 >> weiter.
"Deutschland verlernt seine Kulturtechniken: Die Missachtung des Musikunterrichts ist ein Skandal" von Tobias Riegel | NDS, 18. März 2020 >> weiter.
"Was kosten Kinder?" - Studie "Kosten von Kindern. Erhebungsmethoden und Bandbreiten" von Stefan Humer, Severin Rapp, Judith Lengyel-Wiesinger / A & W blog >> weiter.
"Kosten von Kindern - Erhebungsmethoden und Bandbreiten" von INEQ Wien, Stefan Humer und Severin Rapp, 24. Januar 2020 >> weiter.
"Kinderarmut: Sie mussten früh erwachsen werden." von Marcus Klöckner | NDS im Interview mit Dr. Irina Volf, 19. März 2020 >> weiter.
"Kinderarmut in Deutschland verharrt auf hohem Niveau" von Dietmar Gaisenkersting, 10. Februar 2020 >> weiter.
"Lehrermangel und Unterrichtsausfall. Soziale Ungleichheit verschärft sich!" von Harold Hambacher, 23. Januar 2020 >> weiter.
"Unser staatlich geprägtes Bildungssystem ist veraltet. Perspektiven der individuellen und sozialen Selbstverwirklichung.", von Lars Grünewald, 13. April 2019, im KN 28.12.2019 >> weiter.
"Digitale Bildung. Frühe Medienkompetenz oder digitale Verdummung?. Wie die Entwicklung der Kinder durch digitale Bildung schwer geschädigt wird." von Herbert Ludwig, 9.12.2019 >> weiter.
"Lobbyismus: 20 von 30 DAX-Unternehmen bieten Unterrichtsmaterial an" von Felix Kamella / LobbyControl, 30. Oktober 2019 >> weiter.
"Stifter und Schenker. Wie der Kommerz das Klassenzimmer kapert." von Redaktion NDS, 17. Oktober 2019 >> weiter.
"Der kleine Erwachsene – oder die Verdummung des Kindes" von Herbert Ludwig, 26. September 2019 >> weiter.
"Wählen mit 16 – oder die Infantilisierung der Politik" von Herbert Ludwig, 4. Juli 2019 >> weiter.
"Digitale Verdummung – wie sie in der Schule veranlagt wird und in der Politik schon angekommen ist!" von Herbert Ludwig, 12. Juni 2019 >> weiter.
"Abgeordnete: Denn sie wissen nicht, was sie beschließen" von Herbert Ludwig, 26. Februar 2019 >> weiter.
"Wie hat sich die Einkommenssituation von Familien entwickelt. Ein neues Messkonzept", Bertelsmann Stiftung Studie 2018, Februar 2018 >> weiter.
"Digitale Bildung – was macht die Politik? Positionen der Parteien im Bundestag." von Lena Herzog / die Debatte, 02. Februar 2018 >> weiter.
"Digitalisierung von Bildung als neoliberales Projekt. Internet als Brandbeschleuniger der Globalisierung und Infrastruktur des neoliberalen Regimes." von Matthias Burchardt, 30. Juli 2017 >> weiter.
"Allmächtiger Staat – Die Fesselung des Bildungslebens" von Herbert Ludwig, 16. Juni 2017 >> weiter.
♦ ♦ ♦
»Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren,
verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten
und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht
mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten.
Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft,
verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander
und tyrannisieren ihre Lehrer.«
(-Sokrates, griechischer Philosoph, * um 469 vChr Athen; † 399 vChr Athen)
► Quelle: Der Artikel erschien am 23. Februar 2023 als Erstveröffentlichung bei RUBIKON >> rubikon.news/ >> Artikel. RUBIKON versteht sich als Initiative zur Demokratisierung der Meinungsbildung, vertreten durch die Geschäftsführerin Jana Pfligersdorffer. RUBIKON unterstützen >> HIER.
Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz 'Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International' lizenziert. >> CC BY-NC-ND 4.0. Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen dürfen Sie es verbreiten und vervielfältigen.
ACHTUNG: Die Bilder und Grafiken sind nicht Bestandteil der Originalveröffentlichung und wurden von KN-ADMIN Helmut Schnug eingefügt. Für sie gelten ggf. folgende Kriterien oder Lizenzen, s.u.. Grünfärbung von Zitaten im Artikel und einige zusätzliche Verlinkungen wurden ebenfalls von H.S. als Anreicherung gesetzt, ebenso die Komposition der Haupt- und Unterüberschriften verändert.
► Bild- und Grafikquellen:
1. Kinder in einer Klassenzimmer. Foto: airunique / unique hwang, Seoul/Korea. Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Foto.
2. Kinder haben ein Recht auf Würde und Mitbestimmung. Foto OHNE Inlet: freepik. (detaillierter Urhebername nicht benannt!) Quelle: freepik >> https://de.freepik.com/ . Freepik-Lizenz: Die Lizenz erlaubt es Ihnen, die als kostenlos markierten Inhalte für persönliche Projekte und auch den kommerziellen Gebrauch in digitalen oder gedruckten Medien zu nutzen. Erlaubt ist eine unbegrenzte Zahl von Nutzungen, unbefristet von überall auf der Welt. Modifizierungen und abgeleitete Werke sind erlaubt. Eine Namensnennung des Urhebers und der Quelle (Freepik.com) ist erforderlich. >> Foto. Der Text wurde von Helmut Schnug eingefügt.
3. Buchcover: »Kinderrechte im Fokus der Bildsamkeit. Ein kritisches Plädoyer aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive« von Kira Ammann, Verlag Velbrück Wissenschaft. 412 Seiten, broschiert, € 44,90 - 1. Auflage 2020, ISBN print: 978-3-95832-227-1, ISBN online: 978-3-7489-1172-2.
4. Sieben lachende Kinder zu einem Kreis formiert. Foto: rawpixel.com. Quelle: freepik >> https://de.freepik.com/ . Freepik-Lizenz: Die Lizenz erlaubt es Ihnen, die als kostenlos markierten Inhalte für persönliche Projekte und auch den kommerziellen Gebrauch in digitalen oder gedruckten Medien zu nutzen. Erlaubt ist eine unbegrenzte Zahl von Nutzungen, unbefristet von überall auf der Welt. Modifizierungen und abgeleitete Werke sind erlaubt. Eine Namensnennung des Urhebers (rawpixel.com) und der Quelle (Freepik.com) ist erforderlich. >> Foto.
5. »Es ist nicht vorstellbar, dass unsere Kultur vergisst, dass sie Kinder braucht. Aber dass Kinder eine Kindheit brauchen, hat sie schon halbwegs vergessen.« (- Neil Postman: »Das Verschwinden der Kindheit«).
Neil Postman (* 8. März 1931 in New York; † 5. Oktober 2003 ebenda) war ein US-amerikanischer Medienwissenschaftler, insbesondere ein Kritiker des Mediums Fernsehen und in den 1980er-Jahren ein bekannter Sachbuchautor. Einige seiner bekanntesten Werke wurden von KN-ADMIN Helmut Schnug bereits vor Jahren mit Begeisterung mehrmals gelesen: (die Bücher gibt es mittlerweile antiquarisch für sehr wenig Geld bei BOOKLOOKER.de
»Das Verschwinden der Kindheit«, Fischer, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-596-23855-2. (The Disappearance of Childhood, 1982)
»Wir amüsieren uns zu Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie«, Fischer, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-10-062407-6. (Amusing Ourselves to Death, 1985.).
»Die Verweigerung der Hörigkeit«, Fischer, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-10-062408-4. (Conscientious Objections: Stirring Up Trouble About Language, Technology and Education, 1988)
»Das Technopol. Die Macht der Technologien und die Entmündigung der Gesellschaft«, Fischer, Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-10-062413-0. (Technopoly. The Surrender of Culture to Technology, 1992).
»Wir informieren uns zu Tode.«, 1992 DNB 948188960. (How to Watch TV News, mit Steve Powers, 1992)
»Keine Götter mehr. Das Ende der Erziehung.«, dtv, München 1995, ISBN 3-423-36046-1. (The End of Education, 1995).
6. Mädchen mit traurigem Blick. Die Mündigkeit der Unmündigen: Kindeswohl und Kinderrechte. Die Frage der normativen Bestimmung von Kinderrechten steht im Zusammenhang und teilweise auch im Konflikt mit Gruppeninteressen, vor allem von Frauen, Männern, Bildungsinstitutionen, Kultusministerien, der Werbeindustrie etc..
Ein Kinder wird von Anfang an auf seine Rolle im Erwachsenenleben 'vorbereitet', wobei man eher von 'fremdbestimmter Konditionierung und Indoktrination' sprechen sollte. Kindergefühle, Kinderinteressen, Kindeswohl, Kinderrechte und die Würde eines Kindes bleiben oftmals auf der Strecke, was der freien Kindesentfaltung und Kindesentwicklung zuwiderläuft.
Kinder und Jugendliche empfinden dabei ein tiefes Gefühl von Machtlosigkeit, Geringschätzung, Marginalisierung, Demütigung, Entwürdigung und Ausschluss. Seelische und psychische Erkrankungen sind vorprogrammiert und begleiten Kinder und Jugendliche oft ihr Leben lang. Foto: Inactive account – user ID 19420761. Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Foto.
7. Buchcover: »Adultismus: Die Macht der Erwachsenen über die Kinder. Eine kritische Einführung.« Von Manfred Liebel und Philip Meade. Verlag Bertz + Fischer GbR Berlin, Januar 2023, Taschenbuch 440 Seiten, 13 Fotos, ISBN 978-3-86505-768-6, Preis 19,00 EUR.
8. Buchcover »Unerhört. Kinder und Macht.« von Manfred Liebel, Verlag BELTZ JUVENTA in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel, broschiert, 336 Seiten, ISBN: 978-3-7799-6152-9. Erschienen: 12.02.2020. Preis 29,95 EUR. Auch als EBOOK/PDF für 27,99 EUR.

